 |
| Die vielen Wege des russischen Öls – wie kam Diesel auf Umwege und umging westliche Sanktionen? Im Bild: Kapitän Paris. (Quelle: Maritimeoptima) |
Die Captain Paris, ein griechisches Schiff, das gerade 730.000 Barrel Diesel aus Russland geladen hatte, erreichte den Suezkanal. Die Besatzung kannte die Route, die sie normalerweise nimmt, um Öl vom Golf oder aus Indien nach Europa oder Afrika zu transportieren.
Dieses Mal jedoch steuert das Schiff im Rahmen eines neuen Plans eine andere Richtung an: Es soll seine Ladung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) löschen.
Umleitung des Ölweges
Als die EU im Februar 2023 den Import von raffiniertem Öl aus Russland verbot, befürchteten viele, das Land könnte seine enormen Dieselexporte umlenken. Diese beliefen sich im vergangenen Jahr auf 950.000 Barrel pro Tag und machten den Großteil der 65 Milliarden Dollar schweren russischen Erdölproduktverkäufe aus.
Ende letzten Jahres, als die EU noch zwei Drittel der russischen Exporte kaufte, sprangen China und Indien rasch ein und ersetzten den europäischen Boykott russischen Rohöls. Sie schienen sich über das EU-Verbot nicht zu ärgern.
Der übrige Markt ist fragmentiert. Doch wie das Abenteuer der Captain Paris zeigt, wurden die Handelsrouten umgeleitet. Neue Käufer sind aufgetaucht – und neue Wege, Geld zu verdienen, indem sie die Sanktionen ausnutzen.
Ein Blick auf die aggregierten Handelszahlen lässt vermuten, dass das europäische Embargo nie verhängt wurde. Im März 2023 erreichten die russischen Dieselexporte mit 1,3 Millionen Barrel pro Tag einen Rekordwert. Zwar ist diese Zahl seit Mai unter 900.000 Barrel pro Tag gefallen, liegt aber weiterhin auf dem Niveau der letzten Jahre. Der Rückgang ist größtenteils auf saisonale Wartungsarbeiten in den Raffinerien zurückzuführen.
Die Länder, die dieses Kunststück ermöglicht haben, lassen sich in zwei Lager einteilen. Erstens diejenigen, die mehr Diesel zu einem günstigeren Preis aus Russland kaufen, um Lieferungen aus anderen Ländern zu ersetzen. Dazu gehören südamerikanische Länder, allen voran Brasilien. Obwohl Brasilien im Januar 2023 nichts aus Russland kaufte, erhielt es im Juni 152.000 Barrel pro Tag, was 60 % seiner gesamten Dieselimporte entspricht.
Auch nordafrikanische Länder wie Algerien, Ägypten und Marokko haben davon profitiert. In den letzten Monaten hat Russland sogar raffiniertes Öl nach Nordkorea exportiert – die erste derartige Lieferung seit 2020.
Zur zweiten Gruppe gehören Länder, die gierig nach „billigen“ russischen Ölprodukten geworden sind. Allen voran die Türkei. Ankara kauft mittlerweile doppelt so viel Diesel aus Russland wie noch im Januar, doch die Exporte wachsen noch schneller. Zwar dürfte die Türkei unter einem neuen Markennamen kaum noch reexportieren, doch könnte sie ihre Nähe zu Europa nutzen, um die russischen Öllieferungen zu „triangulieren“, indem sie die Inlandsnachfrage durch billige Importe deckt und gleichzeitig ihr teureres Produkt in die EU verkauft.
Die Golfstaaten schließen ähnliche Vereinbarungen. Saudi-Arabien importiert seit Jahren keinen Diesel mehr aus Russland, doch seit April übersteigt seine Käufe 150.000 Barrel pro Tag.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Saudi-Arabiens Importe vor dem Sommer steigen, wenn der Strombedarf für die Kühlung stark ansteigt. Doch in diesem Jahr sind gleichzeitig auch die Dieselexporte gestiegen – von April bis Juni um rund 120.000 Barrel pro Tag mehr als in den vergangenen Jahren. Ein Großteil davon geht nach Europa und zunehmend auch nach Asien.
"Geschenk" aus dem Westen
Dieser boomende Handel bedeutet, dass Russlands Exportmaschinerie – neben neuen Kunden – über genügend Schiffe verfügt, um diese zu bedienen. „Saubere“ Produkte wie Diesel können nicht auf konventionellen Tankern transportiert werden, da sie durch Rohöl oder schwerere Produkte verunreinigt werden könnten. Die Route der kleinen globalen Flotte von Dieseltankern könnte sich erweitert haben, da russische Fässer längere Strecken zurücklegen mussten.
Die europäischen Sanktionen vom Februar drohen die Lage noch schlimmer zu machen. Europa verbietet Transportunternehmen, Händlern und Versicherern den Verkauf von russischem Öl, sofern der Preis nicht unter dem G7-Preis von 100 Dollar pro Barrel für Premiumprodukte liegt. Die Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften und die Publicity-Risiken im Umgang mit Russland haben viele westliche Unternehmen davon abgehalten, Geschäfte mit Russland zu machen.
Allerdings sind nicht alle europäischen Unternehmen außen vor. Die Schweizer Riesen Gunvor und Vitol gehörten in den ersten vier Monaten des Jahres immer noch zu den zehn größten Abnehmern russischer Ölprodukte, heißt es in dem Bericht, der sich auf Zolldaten beruft. Beide Unternehmen erklärten, sie hätten die einschlägigen Vorschriften eingehalten.
Der Rest besteht aus „kommerziellen Waffen“ russischer Energiekonzerne und ihrer Partner in Hongkong (China), Singapur oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. An Lastkähnen für den Öltransport scheint es ihnen nicht zu mangeln. Mittlerweile kommen auch viele innovative Techniken zum Einsatz.
Die Schiff-zu-Schiff-Transfers mit russischer Fracht, insbesondere in der Nähe von Griechenland und Malta, haben seit letztem Jahr stark zugenommen. Dies deutet auf Versuche hin, die Beschränkungen zu umgehen. Die EU räumte dies am 21. Juni ein und kündigte an, Tankern, die des Schmuggels verdächtigt werden, die Einfahrt in ihre Häfen zu verbieten.
In den letzten Jahren machten russische Exporte etwa 15 Prozent des weltweiten Dieselhandels aus. Die Widerstandsfähigkeit Russlands gegenüber den Sanktionen dürfte für den Rest des Jahres zu einem Überangebot führen.
Die Preise stiegen 2022 sprunghaft an, da das Risiko von Störungen mit einer Erholung der Nachfrage nach der Pandemie zusammenfiel. Doch die Angebotsschocks klingen nun ab, da die Golfstaaten ihre Raffineriekapazitäten erweitern und das nachlassende Wirtschaftswachstum den westlichen Konsum dämpft. Die Kosten für ein nach Rotterdam geliefertes Binnenschiff mit Diesel sind innerhalb eines Jahres um ein Viertel gesunken. Die Raffineriemargen betragen nur noch ein Drittel des früheren Stands.
Dies würde die angeschlagenen europäischen und wohlhabenden asiatischen Raffinerien treffen, die bereits durch billige Produkte vom Markt verdrängt wurden.
Im besten Fall könnten sie die Raffineriekapazitäten reduzieren, im schlimmsten Fall müssten sie die Kapazitäten drosseln. Wer sich nicht an die Sanktionen des Westens hält, kann sich plötzlich leicht Geld verdienen, wenn es um Rohöl geht.
[Anzeige_2]
Quelle







![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet die 16. Sitzung des Nationalen Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der illegalen Fischerei.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/07/1759848378556_dsc-9253-jpg.webp)

























![[Foto] Der Super-Erntemond leuchtet hell in der Nacht des Mittherbstfestes auf der ganzen Welt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/07/1759816565798_1759814567021-jpg.webp)




















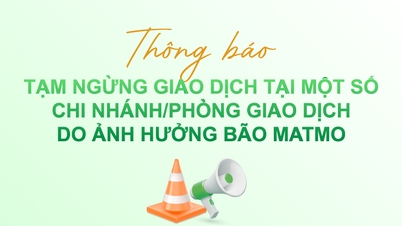
























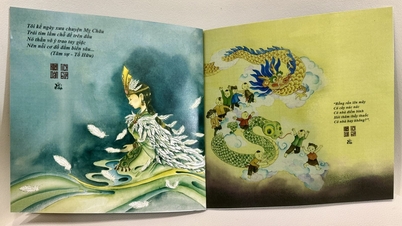























Kommentar (0)