Das Urteil, Trumps Namen von den Wahlzetteln in Colorado zu streichen, wird den Obersten Gerichtshof der USA zum Eingreifen zwingen, was zahlreiche Konsequenzen und Meinungsverschiedenheiten in der US-Politik nach sich ziehen könnte.
Der Oberste Gerichtshof von Colorado entschied am 19. Dezember, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump von den Vorwahlen des Staates auszuschließen, da er an den Unruhen auf dem Capitol Hill beteiligt gewesen sei und daher gemäß Abschnitt 3 des 14. Zusatzartikels zur US-Verfassung nicht für das Präsidentenamt infrage käme.
Der 14. Zusatzartikel zur Verfassung wurde nach fünf Jahren des amerikanischen Bürgerkriegs (1861–1865) verabschiedet, um zu verhindern, dass diejenigen, die der Verfassung die Treue geschworen, sich aber an einer Rebellion oder einem Aufstand gegen das Land beteiligt hatten, erneut für ein Amt kandidieren. „Präsident Trump hat zur Anwendung von Gewalt und gesetzlosem Verhalten aufgerufen und ermutigt, um die friedliche Machtübergabe zu verhindern“, erklärte das Gericht in Colorado in seinem Urteil.
Beobachter gehen jedoch davon aus, dass diese Entscheidung die Vorwahlen in vielen Bundesstaaten stören könnte, in denen Trump wegen angeblicher „Umkehrung“ der Wahlen von 2020 angeklagt wird, sowie die nationalen Wahlen, die im November 2024 stattfinden werden.
Trumps Sprecher verurteilte das Urteil in Colorado als „völlig falsch“ und kündigte an, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen und eine Neuinterpretation des 14. Verfassungszusatzes zu fordern. In diesem Zusammenhang müssen die neun Richter des Obersten Gerichtshofs zum zweiten Mal innerhalb von mehr als zwei Jahrzehnten eine Entscheidung treffen, die über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen entscheiden kann.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump bei einer Gerichtsverhandlung in New York am 6. November. Foto: AFP
Das letzte Mal, dass ein Urteil des Obersten Gerichtshofs eine US-Wahl direkt beeinflusste, war im Jahr 2000, als der Republikaner George W. Bush und der demokratische Vizepräsident Al Gore den 14. Verfassungszusatz anfochten und die Republikaner versuchten, ihre Kandidaten auf dem Weg ins Weiße Haus zu schützen.
Bei der Präsidentschaftswahl 2000 wurde Florida zum entscheidenden Bundesstaat zwischen Al Gore und George W. Bush. Zunächst galt Gore als Sieger Floridas, doch als er sah, dass sein Gegner bei der Auszählung Zehntausende Stimmen Vorsprung hatte, rief er Bush an, um ihm zu gratulieren. Weniger als eine Stunde später nahm Gore sein Zugeständnis zurück, als aktuelle Ergebnisse zeigten, dass sich der Abstand zwischen den beiden deutlich verringert hatte.
Da der Wahlausgang so knapp war, zählte Florida die Stimmen beider Kandidaten nach dem korrekten Verfahren erneut aus. Als die Wahlkommission zahlreiche fehlerhafte Stimmzettel sowie die Gefahr einer Maschinenstörung entdeckte, kam es zu Kontroversen. Der Oberste Gerichtshof Floridas ordnete daraufhin eine manuelle Auszählung aller Stimmzettel an, was das endgültige Ergebnis um mehrere Tage verzögern könnte.
Die Republikaner zogen vor den Obersten Gerichtshof und forderten eine Auslegung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im 14. Verfassungszusatz. Sie argumentierten, der Maßstab, den der Oberste Gerichtshof Floridas allein auf seinen Bundesstaat anwendete, sei unfair gegenüber anderen Bundesstaaten und müsse die Entscheidung zur Neuauszählung für ungültig erklären.
Mehr als einen Monat nach der Wahl entschied der Oberste Gerichtshof der USA mit fünf dafür und vier dagegen zugunsten von Präsident Bush und untersagte damit Florida die manuelle Neuauszählung der Stimmen. Al Gore wollte das Chaos der amerikanischen Politik nicht verlängern, legte daher keine Berufung ein und erklärte seine Niederlage in Florida. Herr Bush gewann mit mehr Wahlmännerstimmen, verlor jedoch rund sechs Millionen Stimmen an Gore.
Der Fall Bush gegen Gore hat die Glaubwürdigkeit des Obersten Gerichtshofs beeinträchtigt, da die Entscheidungen der Richter direkten Einfluss auf die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen haben. Gegner argumentieren, dass Nachzählungen Aufgabe der Wahlbehörden der Bundesstaaten seien und der Oberste Gerichtshof sich daher durch seine Einmischung in Entscheidungen auf Bundesstaatsebene falsch verhalten habe.
Mehr als 20 Jahre später muss der Oberste Gerichtshof der USA erneut in den Wahlprozess eingreifen. Beobachter befürchten, dass der Ruf des Gerichts weiterhin gefährdet sein wird, da die amerikanische Gesellschaft tief gespalten ist zwischen zwei Strömungen, die Trump unterstützen und denen, die ihn ablehnen.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump spricht im Januar 2022 in Conroe, Texas, zu seinen Anhängern. Foto: Reuters
Das Urteil in Colorado gilt zwar nur für die Vorwahlen zur Wahl des republikanischen Kandidaten, könnte aber auch für die offiziellen Wahlen Ende nächsten Jahres gelten, falls Trump Präsident Bidens Gegenkandidat wird.
Das Urteil könnte auch als Grundlage für ein Gericht des Bundesstaates Georgia und ein Bundesgericht in Washington dienen, um Trump wegen Wahlmanipulation anzuklagen. Der ehemalige US-Präsident hat sich in den Anklagepunkten nicht schuldig bekannt, und die Gerichte des Bundesstaates und des Bundes haben noch kein endgültiges Urteil gefällt.
Trumps Anwaltsteam versucht, vor dem Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen und versucht außerdem, das Urteil des Gerichts in Colorado aufzuheben, um zu verhindern, dass es in anderen Bundesstaaten zu einem Präzedenzfall für Klagen gegen ihn wird, weil er zur Aufhebung der Wahlen 2020 „anstiftet“.
Einige Experten meinen jedoch, dass der Oberste Gerichtshof der USA diesmal über eine stärkere Rechtsgrundlage verfügt, um in das Urteil in Colorado einzugreifen, als im Wahlstreit von 2000.
Im Fall aus dem Jahr 2000 musste der Oberste Gerichtshof prüfen, ob er befugt war, in Floridas Entscheidung zur Stimmauszählung einzugreifen. Dieses Mal wandte das Gericht in Colorado den 14. Zusatzartikel zur US-Verfassung an, um Trump zu disqualifizieren. Der Oberste Gerichtshof hat daher die volle Befugnis, den Fall zu behandeln und einzugreifen, sagte Luke Sobota, ein Mitarbeiter des ehemaligen Obersten Richters William Rehnquist, der den Streit zwischen Al Gore und George W. Bush schlichtete.
„Da Herr Trump in vielen anderen Bundesstaaten mit ähnlichen Fällen konfrontiert ist, muss der Oberste Gerichtshof klären, ob die vom Gericht in Colorado zitierte Anti-Aufstands-Klausel angemessen ist oder nicht, um zu verhindern, dass jeder Bundesstaat diese Bestimmung anders auslegt“, sagte Sobota, mittlerweile leitender Anwalt bei der internationalen US-Kanzlei Three Crowns.
Alexander Reinert, Juraprofessor an der Yeshiva University in New York, sagte, dass jede Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, sollte er den Fall annehmen, tiefgreifende Auswirkungen auf die amerikanische Politik haben würde.
Sollten die Richter zu Trumps Gunsten entscheiden, könnten sie mit Fragen zur Glaubwürdigkeit des mächtigsten Gerichts der USA konfrontiert werden. Der Oberste Gerichtshof ist überwiegend konservativ und hat drei von Trump ernannte Richter.
Sollten sie jedoch gegen Trump entscheiden, dürften sie mit einer Welle der Wut von Millionen seiner Anhänger konfrontiert sein. Trump hat kürzlich versucht, diese Wut zu schüren, indem er die Entscheidung des Gerichts in Colorado als „Hexenjagd“ und „Wahlmanipulation“ bezeichnete.
Ted Olson, ein Anwalt, der Bush im Fall vor dem Obersten Gerichtshof im Jahr 2000 vertrat, sagte, die Richter sollten Trumps Berufung schnell annehmen. Er argumentierte, die Aufhebung des Colorado-Urteils sei für die amerikanische Politik notwendig, um faire Wahlen zu gewährleisten, da nur die Wähler das Recht hätten, zu entscheiden, wer würdig sei.
„Das Urteil in Colorado hindert die Wähler nicht nur daran, für Trump zu stimmen, sondern auch diejenigen, die gegen den ehemaligen Präsidenten stimmen“, sagte Olson.
Thanh Danh (Laut WSJ, Politico )
[Anzeige_2]
Quellenlink

























![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt am 80. Jahrestag der Regierungsgründung teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/20/3375b78559fa4d558776197d684b8356)

































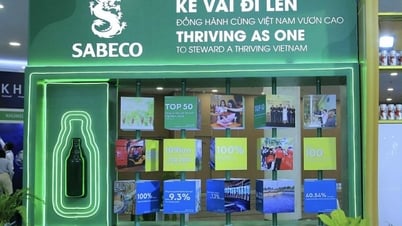









































Kommentar (0)