Schweiz: Am 11. Juni stürzte ein Teil des Fluchthorngipfels in den Silvretta-Alpen plötzlich ein, wodurch mehr als 100.000 Kubikmeter Felsgestein ins Tal stürzten.
Ein Teil des Fluchthorngipfels stürzte ein. Foto: Christian Hutter
Der Erdrutsch ereignete sich nach einer langen Periode hoher Temperaturen in der Schweiz, möglicherweise aufgrund schmelzenden Permafrosts. Wissenschaftler warnen, dass ähnliche Ereignisse eintreten könnten, da der Klimawandel uralten gefrorenen Boden auftauen lässt, berichtete Live Science am 26. Juni.
Bergretter Riccardo Mizio sagte, das Gipfelkreuz sei verschwunden, niemand sei durch die herabfallenden Steine verletzt worden. Der Hauptgipfel des Fluchthorns verlor rund 100 Meter. Der Absturz ereignete sich auf der Westseite, im Futscholtal. Der Mittelgipfel mit 3397 Metern ist nun der höchste Punkt des Fluchthorns, der Berg ist damit rund 19 Meter niedriger als zuvor.
Die meisten Gipfel über 2.500 Meter in den Alpen sind von einer Permafrostschicht bedeckt. Diese dringt in die Risse zwischen den Felsen ein und hält sie zusammen. Ohne diese Permafrostschicht können Berghänge instabil werden, was zu Erdrutschen führen kann.
Der Klimawandel hat erhebliche Auswirkungen auf den Permafrost, da steigende Temperaturen das Eis in den Rissen schmelzen lassen. Dies ist im Sommer nicht ungewöhnlich, wenn die obere Permafrostschicht kurzzeitig schmilzt. Häufigere Hitzewellen in den Alpen führen jedoch dazu, dass das tiefere Eis im Sommer allmählich schmilzt.
Mit der Erwärmung des Bodens dürfte der schmelzende Permafrost weitere Felsmassive der Alpen destabilisieren und zu häufigeren Erdrutschen führen. „Der Gipfel des Fluchthorns war vermutlich seit Jahrtausenden gefroren. Da der langsame Klimawandel auch tiefere Gesteinsschichten beeinflusst, ist der Einsturz des Gipfels wahrscheinlicher auf die extremen Temperaturen im vergangenen Sommer oder Herbst zurückzuführen“, sagt Jan-Christoph Otto, Geologe an der Universität Salzburg.
In den Alpen sind die atmosphärischen Temperaturen in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Laut dem Schweizerischen Wetterdienst steigen die Temperaturen in den Alpen um etwa 0,3 Grad Celsius pro Jahrzehnt und damit etwa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Basierend auf langfristigen Daten, die von Sensoren an der Felswand gesammelt werden, steigt die Durchschnittstemperatur im Fels alle 10 Jahre um 1 Grad Celsius.
Obwohl es unmöglich ist, vorherzusagen, welche Alpengipfel oder -felsen als nächstes einstürzen werden, warnen Experten, dass es im Zuge der globalen Erwärmung zu ähnlichen Felsstürzen kommen wird. Laut Otto gibt es in den Alpen Hunderte von Bergen mit Permafrostboden. „Angesichts des anhaltenden Temperaturanstiegs in den Alpen sind weitere ähnliche Ereignisse wahrscheinlich“, sagt er.
Thu Thao (Laut Live Science )
[Anzeige_2]
Quellenlink








![[Foto] Abschluss der 13. Konferenz des 13. Zentralkomitees der Partei](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/08/1759893763535_ndo_br_a3-bnd-2504-jpg.webp)








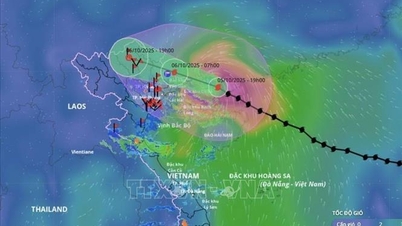


























































































Kommentar (0)