 |
| Die deutsche Industrie gerät ins Hintertreffen – wackelt das Fundament der deutschen Wirtschaft? (Quelle: Financial Times) |
Eine Reihe deutscher Branchen haben Mühe, sich von der durch Covid-19 verursachten Rezession zu erholen, was auf düstere Wirtschaftsaussichten hindeutet, so das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC in einem aktuellen Bericht.
Der Bericht stellt fest, dass die Erholung der deutschen Industrie langsamer verlief als im Durchschnitt anderer Branchen und dass sich die Lage in den letzten Jahren verschlechtert hat.
Nach der Untersuchung des Umsatzwachstums von Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 500 Millionen Euro (556 Millionen US-Dollar) zwischen 2000 und 2022 stellten die Forscher fest, dass sich die Gewinnmargen deutscher Unternehmen in den letzten 22 Jahren fast halbiert haben.
Von allen Sektoren war der Industriesektor stärker betroffen und erholte sich nach Ausbruch der Krise weniger gut als erwartet.
Der Bericht weist auch darauf hin, dass die deutsche Industrie einen Plan zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit entwickeln müsse. Angesichts der Tatsache, dass immer mehr deutsche Unternehmen schwierige Zeiten durchmachen, sei dies eine schwierige Aufgabe.
Ein ähnliches Bild zeichnete eine Umfrage des Zentralverbands Deutscher Mittelständler (ZGV) unter den mittelständischen Unternehmen: 49 Prozent der 42.000 Befragten meldeten im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang.
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit einem Bericht des Ifo-Instituts, der eine Verschlechterung des Geschäftsklimas zeigt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank im Juni 2023 weiter und fiel von 91,5 Punkten im Mai 2023 auf 88,5 Punkte. Die Verschlechterung des Geschäftsklimas ist ein Zeichen dafür, dass die düsteren Konjunkturaussichten anhalten.
Eine am 17. Juli vom Internationalen Währungsfonds (IWF) veröffentlichte Analyse prognostiziert, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 aufgrund der negativen Auswirkungen des Energiepreisschocks und der Verschärfung der Finanzierungsbedingungen um 0,3 Prozent schrumpfen wird.
Unterdessen hat die Inflation in Deutschland nach Monaten der Abschwächung wieder zugenommen, insbesondere in fünf wichtigen Wirtschaftsländern Deutschlands, darunter Nordrhein-Westfalen, Bayern, Brandenburg, Hessen und Baden-Württemberg. Vorläufige Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigten, dass die Inflationsrate in Europas größter Volkswirtschaft von 6,1 % im Mai auf 6,4 % im Juni 2023 gestiegen ist und damit höher ausfiel als die von Analysten prognostizierten 6,3 %.
In den fünf wichtigsten Bundesländern stieg die Inflation auf 6,2 Prozent in Nordrhein-Westfalen und Bayern, 6,7 Prozent in Brandenburg, 6,1 Prozent in Hessen und 6,9 Prozent in Baden-Württemberg. Mit diesen Zahlen wird die Inflationssituation in Deutschland holprig bleiben.
Anfang Juli 2023 verabschiedete die deutsche Regierung den Entwurf des Bundeshaushalts für 2024. Dieser sieht drastische Ausgabenkürzungen vor, nachdem jahrelang hohe Ausgaben zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie und hoher Energiepreise aufgrund des Ukraine-Konflikts getätigt worden waren. Der Haushaltsentwurf sieht Ausgaben für das kommende Jahr in Höhe von bis zu 445,7 Milliarden Euro (485,2 Milliarden US-Dollar) vor, 30 Milliarden Euro weniger als für 2023 geplant. Trotz der Kürzung werden die Ausgaben immer noch 25 Prozent höher sein als 2019.
Noch drastischer sind die Kürzungen bei der Neuverschuldung: Für 2024 ist eine Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro geplant, gegenüber 45,6 Milliarden Euro im Jahr 2023. Diese Neuverschuldung liegt innerhalb der verfassungsmäßigen Grenzen, und auch die „Schuldenbremse“, die die jährliche Neuverschuldung auf 0,35 Prozent des BIP begrenzt, wird das zweite Jahr in Folge eingehalten.
Finanzminister Christian Lindner bezeichnete den Entwurf als einen wichtigen Schritt zur Normalisierung der öffentlichen Finanzen, nachdem die Haushalte jahrelang durch Hunderte Milliarden Euro an neuen Schulden zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Konflikts aufgebläht worden waren und sich alle Ministerien mit Ausnahme des Verteidigungsministeriums an diesen Sparmaßnahmen beteiligen mussten.
Die Europäische Zentralbank (EZB) versucht derzeit, die anhaltende Inflation in der Eurozone durch aggressive Zinserhöhungen zu senken. Seit Juli 2022 hat die EZB die Zinsen um 400 Basispunkte erhöht, was bedeutet, dass sich die Kreditkosten in der Eurozone mehr als verdoppelt haben.
Um die Nachfrage zu drosseln und so die Inflation zu senken, hat die EZB zudem die Reinvestitionsmöglichkeiten der Banken in fällige Anleihen reduziert, was die Finanzierungsbedingungen noch weiter verschärft. Die verschärften Finanzierungsbedingungen halten Unternehmen davon ab, ihre Investitionen auszuweiten.
Einer ZGV-Umfrage zufolge beabsichtigen 27 % der befragten Unternehmen, ihre Investitionen im zweiten Quartal zu reduzieren. Im ersten Quartal 2023 waren es weniger als 9 %.
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Straffungszyklus der EZB bald zu Ende geht. Im Gegenteil, die EZB hat wiederholt erklärt, dass sie ihre Geldpolitik straff halten werde, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent sinkt.
Der jüngsten Prognose der EZB zufolge wird die Inflation in der Eurozone im Jahr 2025 immer noch über 2 % liegen.
[Anzeige_2]
Quelle


![[Foto] Der Super-Erntemond leuchtet hell in der Nacht des Mittherbstfestes auf der ganzen Welt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/07/1759816565798_1759814567021-jpg.webp)


















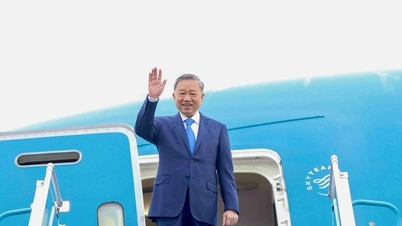

































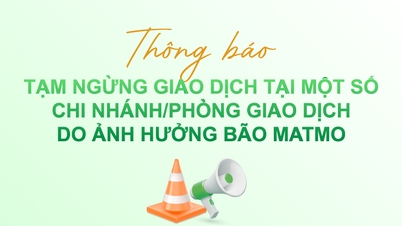



























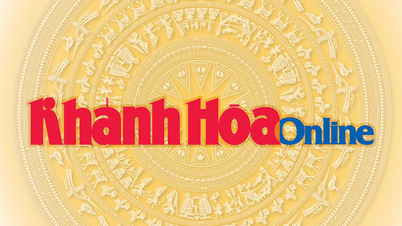




















Kommentar (0)