
Markus Jaeger, Gastprofessor an der Columbia University und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Geopolitik , Geoökonomie und Technologie der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), kommentierte kürzlich in Deutschlands führendem außenpolitischen Magazin INTERNATIONALE POLITIK (IP - ip-quarterly.com/en), dass die Wirtschaftspolitik der Regierung von US-Präsident Donald Trump einen neuen „Zwangsprotektionismus“ schaffe, der dem internationalen Handelssystem schweren Schaden zufüge und die Europäische Union (EU) vor erhebliche Herausforderungen stelle. Die EU müsse sich auf anhaltende Instabilität in den transatlantischen Handelsbeziehungen vorbereiten und ihre geoökonomische Abschreckungspolitik verstärken.
Die größte Veränderung
Der Wandel in der Handelspolitik hin zu einem „zwangsweisen Protektionismus“ ist die bedeutendste Veränderung in der US -Wirtschaftspolitik unter der Trump-Administration 2.0. Diese Politik basiert auf protektionistischen Maßnahmen und Drohungen, um die Handelsabhängigkeit anderer Länder auszunutzen und so wirtschaftliche und politische Zugeständnisse zu erzwingen.
Der durchschnittliche effektive Zoll auf Importe in die USA ist von zwei Prozent auf fast 18 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Stand seit dem berüchtigten Smoot-Hawley Act der 1930er Jahre. Die Regierung hat sektorale Zölle (z. B. auf Stahl, Autos, Kupfer und Pharmazeutika) eingeführt und sogenannte gegenseitige Zölle mit einem Basissatz von zehn Prozent für die meisten Länder angekündigt. Zusätzlich gibt es länderspezifische Zölle, die die bilateralen Handelsbilanzen im Warenbereich widerspiegeln.
Der Mangel an Koordination und die Störungen bei der Formulierung und Umsetzung politischer Maßnahmen, die eher auf präsidiale Launen als auf einen behördenübergreifenden Prozess zurückzuführen sind, tragen zur Instabilität des internationalen Handelssystems bei. Die US-Handelspolitik verfolgt mehrere, nicht immer kohärente Ziele, wobei das hohe US-Handelsdefizit besondere Besorgnis erregt.
Zur Reduzierung des Handelsdefizits: Obwohl „gegenseitige Zölle“ das allgemeine Handelsdefizit reduzieren sollen, zeigen viele Studien, dass die Auswirkungen der Zölle auf das Handelsdefizit sehr gering sind.
Zur Förderung von Produktion und Arbeitsplätzen: Die Trump-Regierung rechtfertigte die Zölle auch damit, dass sie die inländischen Investitionen und die Beschäftigung in der Industrie ankurbeln würden. Allerdings zögern in- und ausländische Unternehmen weiterhin, große Summen zu investieren, da die Unsicherheit darüber besteht, ob die Zölle mittel- bis langfristig bestehen bleiben.
Darüber hinaus ist die Beschäftigung im verarbeitenden Gewerbe in den Industrieländern seit Jahrzehnten rückläufig. Der hart umkämpfte Fertigungssektor in den USA ist mittlerweile eher kapitalintensiv als arbeitsintensiv. Daher dürften die Beschäftigungseffekte höherer Zölle vernachlässigbar oder sogar negativ sein.
Zu den Einnahmen und der nationalen Sicherheit: Das Einnahmeziel der US-Regierung ist der einzige Grund, für den es klare Belege gibt. Das Congressional Budget Office der USA schätzt, dass höhere Zölle (nach Anpassung) das kumulierte US-Haushaltsdefizit im nächsten Jahrzehnt um 3,3 bis 4 Billionen US-Dollar reduzieren werden.
Darüber hinaus wird häufig die nationale Sicherheit als Grund für sektorale Beschränkungen angeführt (z. B. bei Halbleitern oder seltenen Erden). Diese Beschränkungen können zwar dazu beitragen, die Importabhängigkeit zu verringern und die langfristige Versorgungssicherheit zu verbessern, erhöhen aber auch die Kosten und erfordern Zeit für den Aufbau inländischer Produktionskapazitäten.
Transatlantische Spannungen und die Lehre der Abschreckung
Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA stehen vor erheblichen Herausforderungen. Neben der Erhöhung sektoraler Zölle (z. B. auf Stahl und Autos) verhängte die US-Regierung im Rahmen sogenannter „Reziprokzölle“ zunächst einen 30-prozentigen Zoll auf EU-Importe. Dieser wurde später ausgesetzt, um bilaterale Verhandlungen zu ermöglichen. Obwohl die EU als Reaktion auf die sektoralen Zölle und „Reziprokzölle“ Vergeltungszölle vorbereitet hatte, verzichtete sie auf deren Umsetzung, um die Verhandlungen nicht zu gefährden.
Die EU hat zudem darauf verzichtet, ihr neu geschaffenes Instrument der Anti-Enforcement-Politik zu aktivieren, das stärkere wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen ermöglichen würde. So würde beispielsweise die Möglichkeit, mit Beschränkungen der US-Dienstleistungsexporte in die EU zu drohen, Brüssels Verhandlungsposition stärken, auch weil die USA ein wichtiger Dienstleistungsexporteur in die EU sind. Der US-Handelsüberschuss im Dienstleistungssektor mit der EU entspricht fast dem Handelsüberschuss der EU im Warensektor mit den USA.
Zwar könnte die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen schnell zu einer unerwünschten Eskalation führen. Doch eine erfolgreiche geoökonomische Abschreckung kann ein sehr wirksames Instrument sein, um kostspielige Handelskonflikte zu vermeiden oder zumindest eine Einigung zu günstigeren Bedingungen zu erzielen. Die EU war jedoch in ihren Verhandlungen mit der Trump-Regierung nicht bereit, genügend Risiken einzugehen.
China scheute sich beispielsweise nicht, auf US-Zollerhöhungen zu reagieren. Als die entsprechenden Zölle auf über 100 Prozent angehoben wurden, erklärte sich Washington bereit, die Spannungen abzubauen und eine Verhandlungslösung anzustreben. Wie Pekings Bereitschaft, den Export wichtiger Rohstoffe zu beschränken, zur Deeskalation der Spannungen beigetragen hat, bleibt offen. Die Tatsache, dass die Trump-Regierung mit kostspieligen Vergeltungsmaßnahmen reagierte und Washington im April dieses Jahres die „Vergeltungszölle“ aussetzte, nachdem ihre Ankündigung erhebliche Volatilität an den Finanzmärkten verursacht hatte, zeigt jedoch, dass die Trump-Regierung den steigenden wirtschaftlichen und finanziellen Kosten von Handelskriegen nicht gleichgültig gegenübersteht.
Brüssel und Washington haben Ende Juli ein „politisches“ Handelsabkommen unterzeichnet, das jedoch noch nicht rechtsverbindlich ist. Im Rahmen des Abkommens werden die USA Zölle von bis zu 15 Prozent auf Importe aus der EU erheben, darunter auch auf Autos und Autoteile. Dies gilt auch für künftige Zölle auf Arzneimittel und Halbleiter. Die Zölle auf viele andere Güter, darunter Flugzeuge und Flugzeugteile, werden auf das vorherige Niveau gesenkt. Auch die US-Quoten für Stahlimporte aus der EU werden auf ein „historisches Niveau“ zurückgesetzt.
Die EU hat sich außerdem verpflichtet, 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren und Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu importieren. Es ist jedoch noch unklar, wie die EU diese Verpflichtungen genau umsetzen wird. Darüber hinaus werden alle EU-Zölle auf Industriegüter aus den USA abgeschafft. Beide Seiten haben sich zudem verpflichtet, nichttarifäre Handelshemmnisse abzubauen. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Meinungsverschiedenheiten darüber, was dies in der Praxis bedeutet. Dies könnte zu weiteren Streitigkeiten und Unsicherheiten in den bilateralen Handelsbeziehungen führen, unter anderem über Digitalsteuern, EU-Umweltvorschriften und den Umgang der EU mit US-Technologieunternehmen.
Angesichts der Hungersnot empfiehlt Professor Jaeger der EU, ihre Bemühungen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherheit durch Exportdiversifizierung zu beschleunigen und importbezogene Schwachstellen zu verringern. Angesichts der stark transaktionsorientierten und auf Zwangsprotektionismus basierenden US-Handelspolitik sollte die EU die Bereitschaft der aktuellen US-Regierung, glaubwürdige und dauerhafte Abkommen zu schließen, nicht überschätzen.
Quelle: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/thue-quan-my-day-eu-vao-the-phong-thu-thuong-mai-20251018073624750.htm



![[Foto] Tauchen Sie ein in die farbenfrohe Musikwelt von „Secret Garden Live in Vietnam“](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/18/1760805978427_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-41-png.webp)
![[Foto] Generalsekretär To Lam nimmt am 95. Jahrestag des Traditionstags der Parteizentrale teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/18/1760784671836_a1-bnd-4476-1940-jpg.webp)
![[Foto] Abschlusszeremonie des 18. Kongresses des Parteikomitees von Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/17/1760704850107_ndo_br_1-jpg.webp)

![[Foto] Abfall sammeln, grüne Samen säen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/18/1760786475497_ndo_br_1-jpg.webp)















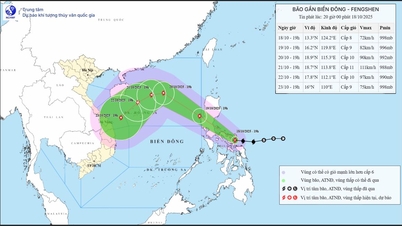








































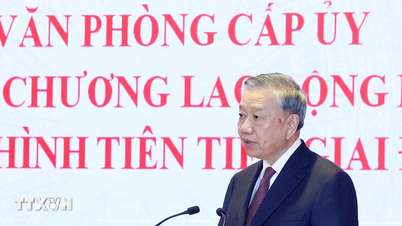









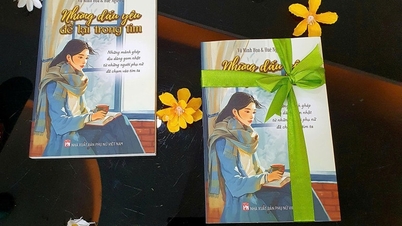







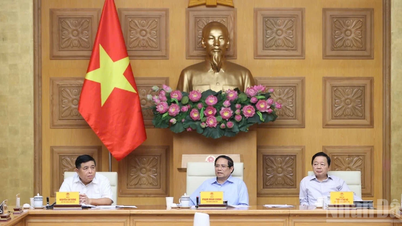













Kommentar (0)