„Eigentlich habe ich ein bisschen Angst.“
Dies war das Geständnis von Sam Altman, CEO von OpenAI und einer der Hauptarchitekten der globalen KI-Revolution, als er über das Potenzial der von ihm geschaffenen Technologie sprach. Er verglich die Geburt der nächsten KI-Generation mit dem Manhattan-Projekt, dem Projekt zum Bau der Atombombe, und warnte vor einer bevorstehenden „nuklearen Machtexplosion“.
Altmans Angst ist mehr als bloße Paranoia vor einer maschinendominierten Zukunft. Sie spiegelt eine alltäglichere Realität wider, die sich in den Vorstandsetagen, Rechenzentren und Regierungskorridoren abspielt: ein neuer Kalter Krieg, ungeschrieben, aber geprägt von Algorithmen, Halbleitern und Datenströmen.
Während die Weltöffentlichkeit mit traditionellen geopolitischen Konflikten beschäftigt ist, verändert eine ernstere Konfrontation still und leise die Weltwirtschaftsordnung. Es handelt sich nicht um einen Krieg mit Waffengewalt, sondern um ein Wettrennen um die Kontrolle über die Technologie, die die Zukunft der Menschheit prägen wird.
Aus geschäftlicher Sicht handelt es sich hierbei um einen Billionen-Dollar-Wettbewerb, bei dem der Gewinner nicht nur Marktanteile gewinnt, sondern auch die Macht hat, die Spielregeln für die gesamte Weltwirtschaft neu zu schreiben.
Neuer Spielplatz, neue Regeln
Der Kalte Krieg um die KI spaltet die Welt in zwei völlig gegensätzliche Technologie- und Geschäftsideologien.
Auf der einen Seite steht der von den USA angeführte Block, der nach einem geschlossenen, monopolistischen KI-Modell operiert. Hier verfügen einige wenige Tech-Giganten wie OpenAI, Google und Anthropic über die leistungsstärksten KI-Modelle und entwickeln diese wie „Walled Gardens“, in denen Technologie ein streng geschütztes Gut ist. Ihr Vorteil ist ihre überlegene technologische Stärke, ein solides Ökosystem und die Fähigkeit, enormes Investitionskapital anzuziehen.
Auf der anderen Seite steht der von China angeführte Block, der eine Open-Source-Philosophie für allgegenwärtige KI verfolgt. Unternehmen wie Alibaba (mit seiner Qwen-Modellreihe), ByteDance (mit Doubao) und insbesondere DeepSeek entwickeln leistungsstarke Modelle und machen sie allgemein verfügbar. Dieser Ansatz demokratisiert die Technologie, macht KI günstiger und zugänglicher und treibt Innovationen im großen Maßstab voran.
Diese Polarisierung ist nicht nur ideologischer Natur, sie wird auch durch aussagekräftige Zahlen untermauert. Laut dem International Finance Forum (IFF) entfallen 57 % der weltweit rund drei Millionen KI-Arbeiter auf die USA und China (USA 32,6 % und China 24,4 %). China bildet mehr KI-Ingenieure aus als jedes andere Land, und seine Rechenleistung wächst in schwindelerregendem Tempo. Bis Juni hatte Chinas gesamte KI-Kapazität 246 Exaflops erreicht und könnte bis Ende des Jahres 300 Exaflops erreichen. Ein Exaflop ist ein Maß für die Leistung eines Supercomputers und bedeutet, dass eine Maschine eine Milliarde Berechnungen pro Sekunde durchführen kann (1.000.000.000.000.000.000.000 Berechnungen/Sekunde).
Diese Konfrontation führt zu einem Paradoxon: China, ein wichtiger Akteur im Open-Source-Ökosystem, hat bei der Gestaltung globaler Sicherheits- und Ethikstandards kaum Einfluss. US-geführte Initiativen wie die Global Partnership on AI (GPAI) und die Bletchley Park-Konferenz zielen darauf ab, Pekings Rolle auszuschließen oder zu begrenzen. Chinas Forderungen, KI als „globales öffentliches Gut“ zu behandeln, werden regelmäßig ignoriert.
Das Ergebnis ist eine Technologiewelt, die auseinandergerissen wird. Unternehmen konkurrieren heute nicht nur um Produkte, sondern auch um Standards, Lieferketten und Wertesysteme.
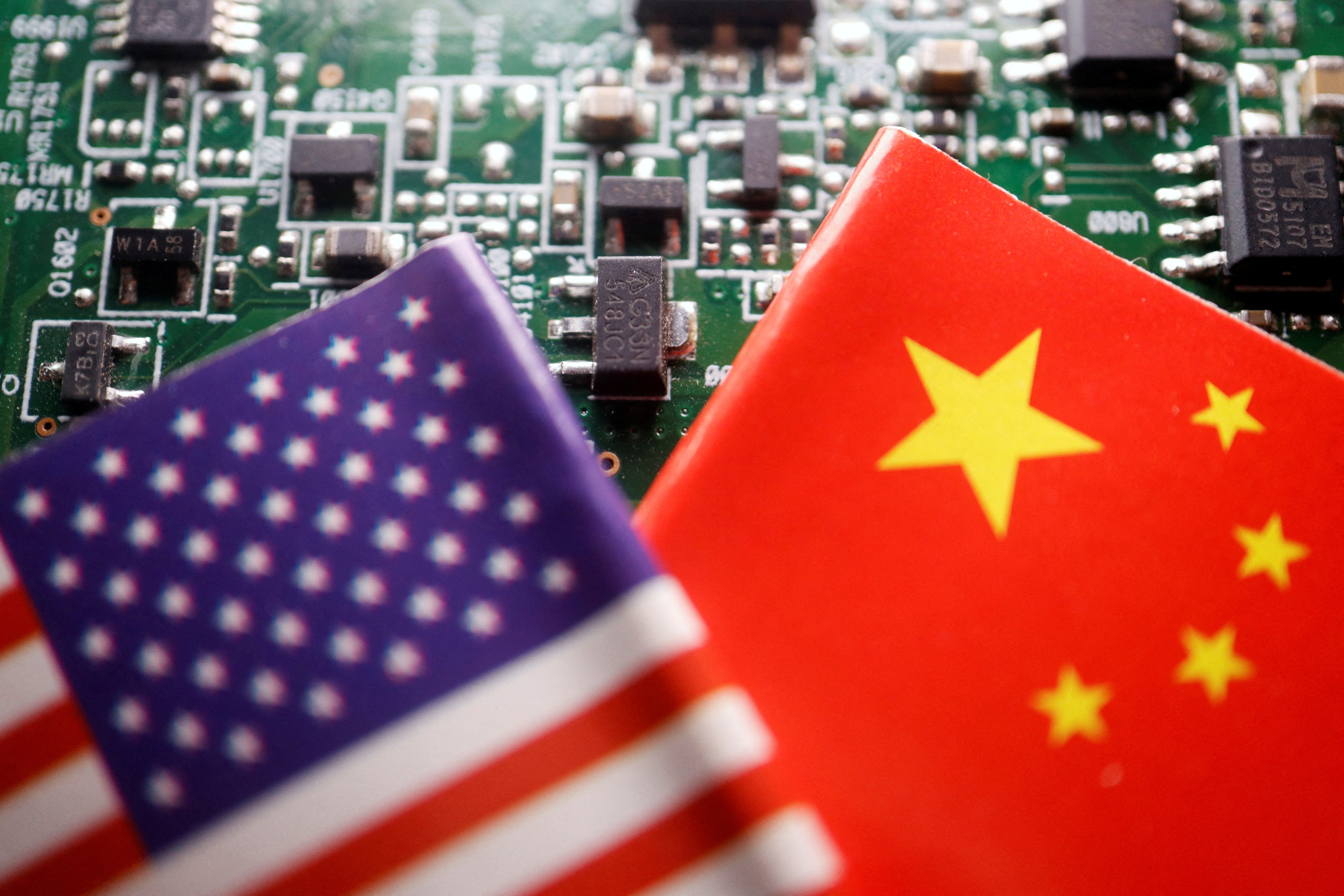
Der Kalte Krieg um die KI ist geprägt von zwei völlig gegensätzlichen Geschäfts- und Technologiephilosophien, die von zwei Supermächten angeführt werden (Foto: Reuters).
Nvidia – Der Gigant zwischen den Fronten
Kein Unternehmen hat die Hitze des KI-Kalten Krieges stärker zu spüren bekommen als Nvidia. Mit einer Marktkapitalisierung von über 4 Billionen US-Dollar ist Nvidia nicht nur ein Chiphersteller, sondern auch ein Waffenlieferant für beide Seiten in diesem Krieg. Und diese Position bringt das Unternehmen in ein Dilemma.
Die Geschichte begann, als Washington die Exportkontrollen verschärfte und Nvidia daran hinderte, seine leistungsstärksten KI-Chips (die Blackwell-Serie) nach China zu verkaufen. Als Grund wurde die nationale Sicherheit angegeben. Nvidia versuchte, das Gesetz zu umgehen, indem es eine schwächere Version, den H20-Chip, speziell für den Milliardenmarkt entwickelte.
Doch das Blatt hat sich gewendet. Chinesische Regierungsvertreter fühlten sich Berichten zufolge durch die Äußerungen von US-Handelsminister Howard Lutnick „beleidigt“. Lutnick hatte erklärt, die USA würden China weder „die beste noch die zweitklassige noch die drittklassige Technologie“ verkaufen. Peking reagierte darauf mit der Anweisung an inländische Unternehmen, keine Nvidia-H20-Chips mehr zu kaufen.
Der Schlag könnte Nvidia Milliarden an Umsatzeinbußen kosten. Der Ergebnisbericht des Unternehmens für das zweite Quartal ließ den Aktienkurs trotz Rekordgewinnen und einer Bruttomarge von 72 Prozent einbrechen. Die Wall Street sorgt sich um den „China-Faktor“, den CEO Jensen Huang treffend als „geopolitische Probleme“ bezeichnet.
Die Position von Nvidia ist derzeit äußerst kompliziert. Das Unternehmen befindet sich in einer Zwickmühle:
Druck aus Washington: Muss sich immer strengeren Sanktionen unterwerfen.
Druck aus Peking: Der chinesische Markt ist nicht nur eine riesige Einnahmequelle, sondern auch eine „strategische Geisel“. Manche halten Chinas Ablehnung des H20-Chips für einen klugen Schachzug, der Nvidia dazu zwingt, sich stärker bei der US-Regierung für die Einführung leistungsstärkerer Chips auf diesem Markt einzusetzen.
Aufstieg der Rivalen: Während Nvidia gebunden ist, entwickeln Konkurrenten wie AMD, Qualcomm und sogar große Kunden wie Google und Amazon aggressiv ihre eigenen KI-Chips, um das Monopol zu brechen.
Die Geschichte von Nvidia ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich Wirtschaft im 21. Jahrhundert nicht mehr von Geopolitik trennen lässt. Das Schicksal des wertvollsten Unternehmens der Welt hängt heute nicht mehr nur von den Ingenieuren in Santa Clara ab, sondern auch von strategischen Überlegungen in Washington und Peking.
Chinas Antwort: Technologische Autarkie
Da China vom Erwerb hochmoderner Technologien ausgeschlossen ist, reagiert es nicht mit Resignation. Stattdessen setzt es voll auf eine ehrgeizige Strategie: technologische Autarkie. Dies ist kein Slogan mehr, sondern ein lebenswichtiges Geschäftsgebot.
Der E-Commerce-Riese Alibaba steht an der Spitze dieser Revolution. Mehreren Quellen zufolge entwickelt Alibaba einen völlig neuen KI-Chip, den Nachfolger des 2019 eingeführten Hanguang 800-Chips. Mit seiner T-Head-Halbleiter-Designeinheit und der Zusage, in den nächsten drei Jahren mindestens 45 Milliarden Euro in KI zu investieren, setzt Alibaba auf eine von Nvidia unabhängige Zukunft.

Der Kalte Krieg um die KI wird in der Geschichte von Nvidia und Alibaba deutlich, zwei Giganten auf entgegengesetzten Seiten der Frontlinie (Foto: TECHi).
Alibabas Strategie ist klug. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, auf dem globalen Chipmarkt direkt mit Nvidia zu konkurrieren. Stattdessen soll der neue Chip intern genutzt werden und Rechenleistung für das riesige Cloud-Service-Ökosystem des Unternehmens bereitstellen. Kunden werden den Chip nicht kaufen, sondern „Rechenleistung von Alibaba“ mieten. Dieses Geschäftsmodell gewährleistet sowohl technologische Sicherheit als auch einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil.
Alibaba ist nicht allein. Huawei hat einen eigenen KI-Chip, und Cambricon entwickelt sich zum aufsteigenden Stern. Nvidia-Chef Jensen Huang hat die US-Regierung wiederholt gewarnt, dass chinesische Unternehmen im Falle eines Verkaufsverbots nach China ihre eigenen Wege finden würden, die Lücke zu füllen. Diese Warnung bewahrheitet sich.
Dieser Schritt geht Hand in Hand mit Pekings diplomatischen Bemühungen. Auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) rief Präsident Xi Jinping zur Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz auf und lehnte gleichzeitig das, was er als „Denken des Kalten Krieges“ bezeichnete, ab. Es handelt sich um eine zweigleisige Strategie: Einerseits geht es darum, die heimischen technologischen Kapazitäten auszubauen, um nicht unterdrückt zu werden; andererseits darum, eine Koalition „gleichgesinnter“ Länder zu bilden, um ein paralleles Ökosystem zu schaffen, in dem China die Regeln bestimmt.
Eine Welt der Technologie zersplittert
Der Kalte Krieg um KI führt zum Einsturz eines „digitalen Eisernen Vorhangs“, der die Weltwirtschaft spaltet. Die Folgen für Unternehmen sind tiefgreifend und komplex.
Fragmentierte Lieferketten: Multinationale Unternehmen, die einst in einer flachen Welt operierten, sehen sich heute mit zwei weitgehend inkompatiblen Technologie-Ökosystemen konfrontiert. Sie müssen Lieferanten, Partner und Technologieplattformen auf der Grundlage ihrer „Nationalität“ auswählen. So hat beispielsweise das amerikanische KI-Unternehmen Anthropic Unternehmen mit chinesischer Mehrheitsbeteiligung die Nutzung seiner Produkte ausdrücklich verboten.
Höhere Kosten und Unsicherheit: Der Betrieb in zwei parallelen Ökosystemen bedeutet zwei F&E-Strategien, zwei Marketingstrategien und zwei Compliance-Systeme. Dies erhöht nicht nur die Kosten, sondern schafft auch ein unsicheres Geschäftsumfeld, in dem sich Vorschriften über Nacht ändern können.
Der Kampf um den „globalen Süden“: Die Entwicklungsländer sind zum zentralen Schlachtfeld dieses Wettbewerbs geworden. Sowohl die USA als auch China versuchen, diese Länder in ihren technologischen Einflussbereich zu ziehen, indem sie Investitionspakete, technische Hilfe und Governance-Standards anbieten. Für diese Länder ist dies sowohl eine Chance auf Entwicklungsressourcen als auch das Risiko, in die Fänge zweier Supermächte zu geraten.
Drittparteienrolle: Die Europäische Union versucht mit dem KI-Gesetz einen dritten Weg zu beschreiten und einen „Brüssel-Effekt“ zu erzeugen, um globale Standards zu setzen. Die große Frage ist jedoch, ob die EU zum Regelmacher werden kann oder ob sie letztlich den von den USA oder China vorgegebenen Regeln folgt. Auch andere Mittelmächte wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien versuchen, eine Brückenfunktion einzunehmen, ihr Einfluss ist jedoch begrenzt.
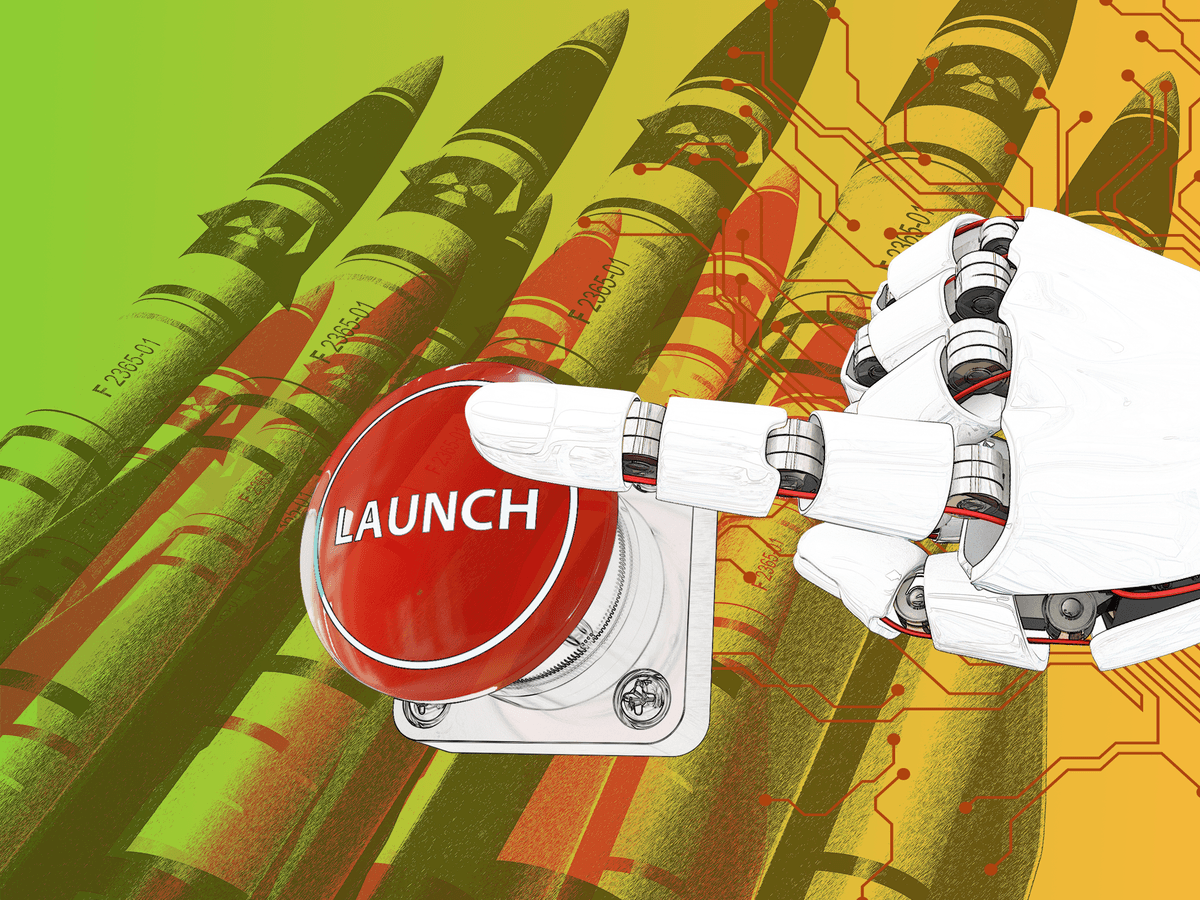
Die Konfrontation zwischen den USA und China bringt die Welt an den Rand eines zersplitterten Technologie-Ökosystems, das zu einer wirtschaftlichen „Atomkrise“ eskalieren könnte (Foto: RAND).
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass ein kleiner Fehler eine globale Katastrophe auslösen kann. Die Lektion aus Sarajevo 1914 gilt nach wie vor. Um zu verhindern, dass der KI-Kalte Krieg zu einer wirtschaftlichen „Kernschmelze“ eskaliert, braucht die Welt mutige, aber sichere Maßnahmen.
Die Stärkung internationaler Mechanismen wie der Vereinten Nationen bei der Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens für das Risikomanagement ist ein erster Schritt. Die Bletchley-Erklärung, an der sowohl die USA als auch China beteiligt waren, bildet eine wichtige Grundlage, muss aber durch verbindliche Sicherheits- und Transparenzstandards untermauert werden.
Technische Zusammenarbeit, insbesondere in den Bereichen Open Source und gemeinsame Forschung, könnte eine Brücke zur Wiederherstellung des Vertrauens sein. Die USA könnten im Austausch für gemeinsame Sicherheitsabkommen mit China eine Lockerung einiger Exportbeschränkungen in Erwägung ziehen. Mittelmächte könnten eine vermittelnde Rolle spielen, da die VAE bei KI-Schulungsprogrammen mit der Universität Oxford kooperieren.
Gelingt dies nicht, bietet sich ein düsteres Bild: ein zersplittertes globales Ökosystem, in dem eine von den USA geführte Allianz teure proprietäre Technologien hortet, China eine separate Open-Source-Welt dominiert und der Rest der Welt um die Reste kämpft. Unkontrollierter Wettbewerb, egal aus welchem Grund, kann unsichtbare Dämonen entfesseln. Die Aufgabe der Wirtschafts- und Regierungschefs besteht nun darin, die Glut der KI-Governance zu löschen, bevor sie zu einem Flächenbrand explodiert, der die Weltwirtschaft erfasst.
Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chien-tranh-lanh-ai-chay-dua-viet-lai-luat-choi-toan-cau-20250908110847999.htm






![[Foto] Das Politbüro arbeitet mit den Ständigen Ausschüssen der Provinzparteikomitees von Vinh Long und Thai Nguyen zusammen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/8/4f046c454726499e830b662497ea1893)

![[Foto] Generalsekretär To Lam leitete die Arbeitssitzung des Politbüros mit den Ständigen Ausschüssen der Parteikomitees der zentralen Parteiagenturen.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/9/8343386e1e8f43c6a3c0543da7744901)








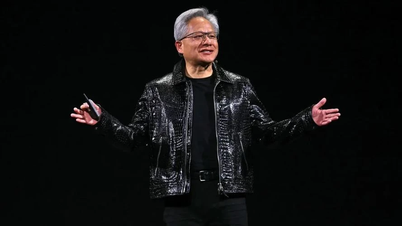



















![[Foto] Das Politbüro arbeitet mit den Ständigen Ausschüssen der Parteikomitees der Provinzen Phu Tho und Dong Nai zusammen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/8/f05d30279b1c495fb2d312cb16b518b0)
![[Foto] Das Politbüro arbeitet mit den Ständigen Ausschüssen der Parteikomitees der Provinzen Dong Thap und Quang Tri zusammen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/8/3e1c690a190746faa2d4651ac6ddd01a)



































































Kommentar (0)