Die globalen Nahrungsmittelmärkte sind erneut in Aufruhr – nicht nur wegen der Entscheidung Russlands, aus dem Getreideabkommen mit dem Schwarzen Meer auszusteigen, sondern auch wegen der Ankündigung Indiens, den Export vieler Reissorten zu verbieten.
Das teilweise Exportverbot des größten Reishändlers auf dem Weltmarkt, der rund 40 Prozent der Exporte ausmacht, hat Befürchtungen geweckt, dass die Nahrungsmittelinflation außer Kontrolle gerät, insbesondere in Ländern des globalen Südens, die ohnehin schon mit hoher Verschuldung und steigenden Lebensmittel- und Treibstoffpreisen zu kämpfen haben. Selbst wenn das Exportverbot bald aufgehoben wird, ist es für Indien sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch eine einschneidende Entscheidung. Es untergräbt die jüngsten Behauptungen indischer Politiker, das Land sei eine natürliche und verantwortungsvolle Führungspersönlichkeit in den Entwicklungsländern.
 |
Neu-Delhi begründet seine Entscheidung mit steigenden Lebensmittelpreisen im Inland und den bevorstehenden Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Eine niedrige Lebensmittelinflation ist traditionell ein entscheidender Faktor für den Wahlerfolg in Indien – und die Reispreise im Inland sind im vergangenen Jahr um mehr als 10 Prozent gestiegen.
Den meisten indischen Ökonomen ist unklar, warum ein Exportverbot die beste Lösung für die inländischen Verbraucher sein soll, wenn die Regierung gleichzeitig große Mengen Reis hortet, die problemlos an ärmere Inder verteilt oder auf den freien Markt gebracht werden könnten, um die Preise zu senken.
Für die Verantwortlichen in Neu-Delhi sind Exportverbote die erste, nicht die letzte Reaktion auf die steigenden Inlandspreise. Nur wenige Monate, nachdem Russland im vergangenen Jahr den ukrainischen Weizenmarkt erobert hatte, stoppte Indien beispielsweise erneut seine Weizenexporte und verschärfte damit die Ernährungsunsicherheit in den Schwellenländern, gerade als diese am verwundbarsten waren.
Indien behauptet oft, selbst gegenüber der Welthandelsorganisation, seine restriktive Handelspolitik diene dem Schutz von Millionen von Subsistenzbauern. Doch in Wirklichkeit hätte die Regierung, wenn die landwirtschaftlichen Einkommen oberste Priorität hätten, nicht die Exporte eingestellt, als die Preise stiegen und die Bauern kaum Gewinne machten. Will Indien eine Führungsrolle in der Welt übernehmen, muss es verstehen, dass seine Entscheidungen globale Auswirkungen haben. Selbst in reicheren Ländern wie den USA strömen Verbraucher – viele aus der indischen Diaspora – in die Supermärkte, um sich mit indischen Reissorten einzudecken.
Indische Politiker verteidigen sich schnell gegen solche Vorwürfe. Sie weisen darauf hin, dass das Verbot nicht für Indiens beliebtesten Reis, Basmati, gilt. Für Inder im Ausland, insbesondere aus Südindien, die kurzkörnigen Reis bevorzugen, ist das ein schwacher Trost.
Die Regierung weist darauf hin, dass Indien trotz des im vergangenen Jahr angekündigten Exportverbots im Sommer 2022 fast doppelt so viel Weizen exportierte wie im Vorjahr. Dies liegt nicht an Lecks im System, sondern zum Teil daran, dass vor dem Verbot unterzeichnete Verträge noch eingehalten wurden. Es liegt aber auch daran, dass andere Regierungen in Indien Lobbyarbeit betreiben konnten, um Ausnahmen für bestimmte Weizenlieferungen zu machen. Ein ähnliches System soll auch für Reis gelten.
Indiens Entscheidung dürfte Vergeltungsmaßnahmen provozieren. Tatsächlich könnten die Gegenreaktionen rasch eskalieren, wenn die weltweiten Reispreise ein Zehnjahreshoch erreichen. Und die Welt macht Indiens Verbot zu einem großen Teil für den Reismangel verantwortlich.
[Anzeige_2]
Quellenlink



![[Foto] Der Generalsekretär nimmt an der Parade zur Feier des 80. Jahrestages der Gründung der Koreanischen Arbeiterpartei teil](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/11/1760150039564_vna-potal-tong-bi-thu-du-le-duyet-binh-ky-niem-80-nam-thanh-lap-dang-lao-dong-trieu-tien-8331994-jpg.webp)
![[Foto] Ho-Chi-Minh-Stadt erstrahlt am Vorabend des 1. Parteitags (2025–2030) in Fahnen und Blumen](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760102923219_ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-43-png.webp)


![[Foto] Eröffnung des Weltkulturfestivals in Hanoi](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/10/1760113426728_ndo_br_lehoi-khaimac-jpg.webp)































































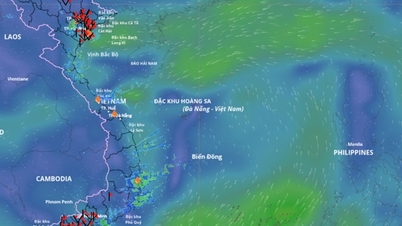













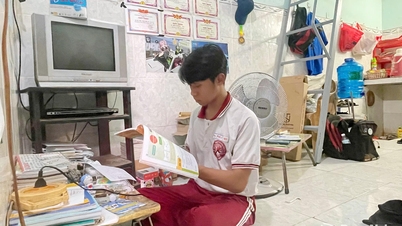





















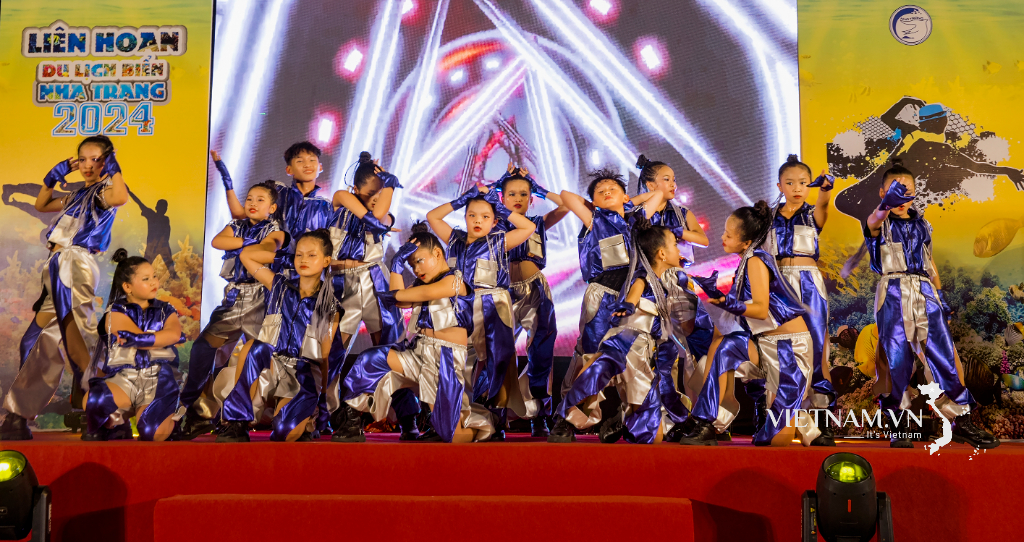


Kommentar (0)