Das Leben um mich herum verläuft immer noch stetig, Tag für Tag in einem sich wiederholenden Kreislauf aus Arbeit, Familie und Freunden. Manchmal bringen diese vertrauten Rhythmen nicht mehr die gleiche Aufregung mit sich wie am Anfang. Ich verstehe das, das ist normal. Deshalb möchte ich jedes Mal, wenn ich einen Moment der Ruhe für mich habe, aus diesem Kreislauf ausbrechen. Und wenn dieser Wunsch stark genug ist, kehre ich in die Berge und Wälder zurück.
Im Zeitalter der digitalen Transformation ist die Reisevorbereitung kein Problem mehr. An nur einem Nachmittag kann ich die Arrangements abschließen: Ein Anruf bei einem vertrauten Reiseführer, ein Anruf zur Buchung eines Bustickets, die Preisvereinbarung und dann nur noch die Abfahrt abwarten. Diese Reise führt mich zurück in die Wildnis, dem Ruf der lila Chi-Pau-Blüte an den Hängen des Ta Chi Nhu-Berges folgend.

Der Gipfel Ta Chi Nhu liegt zwischen den Dörfern Xa Ho, Tram Tau, Lao Cai (alt Yen Bai ) und Nam Nghep, Gemeinde Ngoc Chien, Provinz Son La. Früher wählten die Menschen den Weg von Tram Tau, aber die Straße war steil und voller kahler, felsiger Hügel. Seit der Fertigstellung der Betonstraße, die Nam Nghep mit der Gemeinde Ngoc Chien verbindet, Anfang 2025 ist das abgelegene Dorf mitten im Wald plötzlich zu einem Treffpunkt für Trekking-Enthusiasten geworden.
Der Nachtbus brachte mich vor Sonnenaufgang nach Nga Ba Kim, Pung Luong und Mu Cang Chai. Leichter Regen und kalter Wind zogen auf, sobald ich aus dem Bus stieg. Sie brachten den Hauch des Hochlands mit sich, ganz anders als das heiße und feuchte Wetter meiner Heimatstadt. Der Gepäckträger war seit dem Vornachmittag dort, um meine Sachen vorzubereiten und mich von einem nahegelegenen Motel abzuholen. Als alle fünf Mitglieder der Gruppe versammelt waren, frühstückten wir gemeinsam, lernten uns kennen und warteten auf das Taxi, das uns nach Nam Nghep bringen sollte.
Wir hatten Glück, in der Jahreszeit in Nam Nghep anzukommen, als die Weißdorne reif waren. Die Fruchtbüschel hingen rosig wie die Wangen eines jungen Mädchens von den Zweigen und schwankten im Wind. Die Äpfel hingen schwer an den Zweigen, hingen tief und konnten mit nur einer Handbewegung gepflückt werden. Ich pflückte eine Beere, wischte sie an meinem Hemd ab und biss kräftig hinein. Der süße, leicht herb schmeckende Geschmack breitete sich in meinem Mund aus und erfrischte mich. Interessanterweise war es das erste Mal, dass ich eine Frucht pflückte und aß, die ich bisher nur aus Weinkrügen kannte.

Wir hatten uns im Weißdornwald verirrt, doch der Berg hatte gerade erst begonnen und war noch weit entfernt. Wir ermahnten uns gegenseitig, schneller zu gehen, um den Rückstand aufzuholen. Vom Fuße des 1.200 Meter hohen Berges bis zum Gipfel war die Trekkingroute etwa 18 Kilometer lang (hin und zurück), dauerte zwei Tage und eine Nacht und erforderte ein gewisses Maß an körperlicher Stärke und Geschick. Das Ziel des ersten Tages war, die Rasthütte auf 2.750 Metern Höhe zu erreichen, voraussichtlich am späten Nachmittag.
Es nieselte. Hohe Bäume spendeten Schatten, Moos bedeckte ihre Wurzeln. Der dichte, geheimnisvolle Wald machte meine Schritte noch freudiger. Der Regen kühlte meinen Schweiß. Der Wind blies heftig, der Regen wurde stärker, sodass ich einen Regenmantel anziehen musste. Durch den Wald gingen wir über wilde Hügel, die zu beiden Seiten mit Büschen, Farnen und verdrehten, geschwärzten Baumstümpfen bedeckt waren. Im Regen ging die ganze Gruppe schweigend. Das Tempo unserer Schritte wurde allmählich vertraut, mein Atem vermischte sich mit dem Geräusch des fallenden Regens, und ich fühlte mich plötzlich klein und verschmolz mit den riesigen Bergen und Hügeln.
Dann umarmte uns wieder der grüne Schatten des Urwaldes. Die atemberaubende Landschaft schien die Frage zu beantworten, warum die Nam-Nghep-Route für Waldliebhaber so attraktiv war. Auf einer Ebene angekommen, wurden gesägte Baumstämme zu Rastplätzen umgebaut. Ein einfaches Mittagessen aus weißem Klebreis und ein paar Scheiben Schweinefleischrolle mit Salz und Chili, das wir im Regen unter dem Blätterdach mit unseren Begleitern aßen, wurde zu einem unvergesslichen Genuss. Nach dem Essen sammelten wir den Müll ein, den wir mitgebracht hatten, hinterließen nur Fußspuren auf dem Weg und setzten dann unsere Reise fort.

Von hier bis zur Raststätte sind es etwa drei Stunden. Der Weg führt durch den Wald, über drei oder vier Bäche, Hang um Hang schmiegt sich an den Berghang. Erst wenn man den Bach erreicht, geht es etwas tiefer hinunter, und dann sieht man den steilen Hang, der den Willen herausfordert. Aber gerade an diesen Hängen eröffnet sich die Landschaft so wunderbar. Für mich ist das der schönste Augenblick. Das Rauschen des Baches hallt von weitem wider, als ob es den Weg weist. Wir passieren die Klippe und steigen zum Bachbett hinab. Auf einem Felsen sitzend, schöpfte ich meine Hand in das klare, kalte Wasser und führte sie dann an mein Gesicht. Oben rauschte das Wasser des hohen Berges herab und bildete weißen Schaum. Unten schlängelte sich der Bach durch die Felsspalten und floss endlos.
Als ich vor dieser Szene stand, fühlte ich mich klein, mein Herz erfüllt von Liebe zu den Bergen und Wäldern. Mutter Natur schien die Seelen zu beruhigen und zu tränken, die durch die Hektik des Lebensunterhalts ausgetrocknet waren. Mitten an einem regnerischen Nachmittag im Wald, neben dem kühlen Bach, schien meine Seele gewaschen, wieder weich wie ein Seidenband, wie der Bach selbst, der unermüdlich floss. In mir erwachten Lebensfreude, Dankbarkeit und Gelassenheit.
Von hier aus war es nur noch ein Hang, doch an diesem steilen Hang lag mitten im Wald die Rasthütte, unser Ziel. Mit jedem schweren Schritt, jedem schweren Atemzug und jedem Schweiß fragten alle den Träger: „Sind wir bald da?“ Er war an diese Frage gewöhnt und lächelte nur sanft, während seine schlammigen Stiefel noch immer schnell vorankamen: „Nur noch zwei Bäche!“ Gerade als wir dachten, wir wären erschöpft, brachen wir in Tränen aus, als wir die Rasthütte im weißen Nebel in der Ferne auftauchen sahen. „Wir sind da!“, rief die ganze Gruppe.
Die Unterkunft war etwa 80 Quadratmeter groß und bot Platz für über 30 Personen. Sie war auf einer ziemlich flachen Klippe errichtet. Unten plätscherte ein Bach; ringsum gab es nur Bäume, Wolken und Wind. In dieser Höhe drangen Nebel und Kälte durch jede Ritze in der Wand. Zum Glück hatten wir einen „Retter“: das Feuer, das der Träger gerade anzündete. Das Holz war nass, es dauerte lange, bis es brannte. Beißender Rauch wirbelte um den Ofen, aber alle unterhielten sich und drängten sich zusammen, um die Wärme des roten Feuers zu teilen. Die Kletterfreunde, die sich erst am Morgen nach einer beschwerlichen Reise kennengelernt hatten, saßen eng beieinander, und die Unterhaltung wurde ungezwungen und herzlich.

Der Träger verwandelte sich in einen geschickten Koch. Rasch schnitt er Hühnchen, wusch Gemüse, bereitete Brühe zu und marinierte das Fleisch. Schnell brach die Nacht herein. Ringsum war es stockfinster, der Wind pfiff durch das Laub im Nebel, sowohl trügerisch als auch real. In der Kälte, im flackernden Licht der Taschenlampe, am flackernden Feuer, wurden Geschichten von der Reise und dem Leben erzählt.
Der starke Wein wurde eingeschenkt. Porter hob sein Glas, sagte ein paar Worte zur Begrüßung, alle jubelten und tranken, womit das Abendessen nach einem anstrengenden Klettertag offiziell eröffnet wurde. Der erste Tag ist immer der schwierigste, deshalb war dieses Essen das Beste. Wir aßen und tranken uns satt, dann suchten sich alle früh einen Platz zum Ausruhen, damit wir rechtzeitig für die nächste Reise am nächsten Morgen aufstehen konnten.
Die Nacht war kalt. Die Tür der Hütte war geschlossen, doch Wind und Tau drangen herein. Glücklicherweise duftete die Decke nach Mensch und wärmte sie nach dem anfänglichen Frösteln. Einer nach dem anderen schlief ein, trotz des Nieselregens draußen, der rhythmisch auf das Blechdach prasselte und auf die Plane prasselte. Spät in der Nacht hörte man in der Hütte nur noch das Geräusch von Regen, Wind und gleichmäßigem Atmen.
Am nächsten Morgen, als wir noch tief und fest schliefen, war der Träger bereits aufgestanden, hatte den Herd angemacht, Wasser gekocht und Kaffee, Tee und Frühstück zubereitet. Ich trank einen Schluck heißen Kaffee im Morgennebel, als die Berge und Wälder noch dunstig waren und niemand klar sehen konnte, und spürte sofort, wie mein Körper erwachte und mein Geist erregt war. Die Kälte heute schien nicht so streng wie gestern Nachmittag.


Der zweite Tag verlief einfacher, da wir unsere Rucksäcke in der Hütte zurückließen. Der Weg zum Gipfel begann mit einem schlammigen Pfad, der sich durch den noch dunklen Berghang schlängelte. Die Baumwurzeln verhedderten sich im Boden und trugen zur unheimlichen Atmosphäre bei. Wir kletterten leise, die einzigen Geräusche waren das Quietschen unserer Schuhe auf dem nassen Boden und unser schweres Atmen. Je höher wir stiegen, desto heller wurde der Himmel, der Wind frischte auf und die leuchtend violetten Felder der Chi-Pau-Blumen breiteten sich über den Berghang aus.
Chi-Pau-Blumen sind der Grund, warum in dieser Jahreszeit viele junge Leute nach Ta Chi Nhu strömen. Diese verträumt violette Blume blüht nur etwa zwei Wochen lang. Interessant ist auch der Name „Chi Pau“, der von der Antwort „tsi pau“ (weiß nicht) eines Mong-Volkes stammt, als er nach dieser Blume gefragt wurde. Doch durch soziale Netzwerke ist dieser witzige Name bekannt geworden. Tatsächlich handelt es sich um das Drachenhoniggras aus der Familie der Enziangewächse, ein Volksheilmittel.
Je näher wir dem Gipfel kamen, desto mehr Chi-Pau-Blumen gab es, desto dunkler wurde das Lila. Zwei Mädchen aus der Gruppe waren ganz vertieft in das Fotografieren im Blumenmeer. Und dort, hinter den lila Blumen, tauchte der Ta Chi Nhu-Gipfel auf. Der kalte, glänzende Edelstahlgipfel mit der eingravierten Höhe von 2.979 m war von mehr als einem Dutzend Menschen umgeben, die schon vor uns angekommen waren. Der Wind blies uns entgegen, und überall zogen Wolken auf. Leider war das Wetter heute Morgen nicht nach unserem Geschmack: Das Wolkenmeer und der goldene Sonnenaufgang mussten bis zum nächsten Mal warten. Aber egal. Schon das Betreten des „Dachs von Yen Bai“ war ein Grund zum Stolz.
Die Kälte beschlug die Handylinse. Ich trocknete sie, holte die rote Flagge mit dem gelben Stern hervor, die ich mitgebracht hatte, und bat meinen Begleiter, ein Erinnerungsfoto zu machen. Dieses Foto, obwohl nicht so strahlend wie erhofft, war dennoch der schönste Meilenstein: Der Tag, an dem ich Ta Chi Nhu bezwang, inmitten von Wind, Wolken, Himmel und dem tiefvioletten Licht der Chi Pau-Blumen. Ein einfacher, aber glücklicher Moment.
Quelle: https://baosonla.vn/van-hoa-van-nghe-the-thao/ta-chi-nhu-hoi-tho-nui-rung-va-sac-hoa-chi-pau-AgqIafqNR.html



![[Foto] Schüler der Binh Minh Grundschule genießen das Vollmondfest und erleben die Freuden der Kindheit](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/8cf8abef22fe4471be400a818912cb85)
![[Foto] Premierminister Pham Minh Chinh leitet Treffen zur Bewältigung der Folgen von Sturm Nr. 10](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/3/544f420dcc844463898fcbef46247d16)
























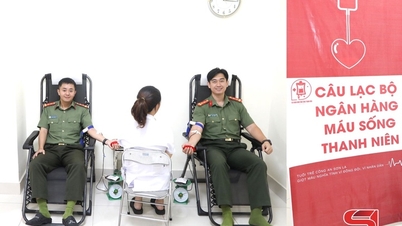











































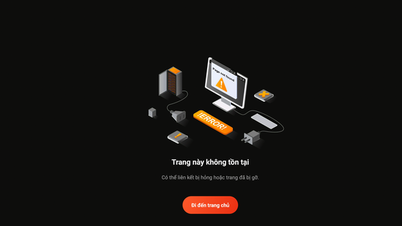






























Kommentar (0)