
Die Geschichte der Universitätsnoten in Vietnam spiegelt eine lange Reise der Transformation wider – Illustration Foto AI
Erinnerungen an eine „erstickende“ Zeit
Gehen wir zurück in die frühen 2000er Jahre, an renommierte Universitäten mit strenger Benotungskultur wie Architektur, Polytechnikum, Medizin und Pharmazie. Dort war die „knausrige Benotung“ fast schon zu einer unausgesprochenen Norm geworden, die über viele Generationen hinweg aufrechterhalten wurde.
Egal wie aufwendig und sorgfältig ein Architekturprojekt ist, es ist schwierig, die Schwelle von 7 zu überschreiten. Eine Punktzahl von 8 ist bereits eine stolze Leistung, während eine Punktzahl von 9 so selten ist, dass sie zu einer Legende geworden ist und oft von Lehrern als Zeugnis für den Exzellenzstandard „aufgehoben“ wird, auf das sich zukünftige Generationen beziehen können.
Hinter dieser Strenge verbirgt sich eine klare pädagogische Philosophie: Das wirkliche Leben ist viel härter. Ein „echtes“ Ergebnis hilft den Schülern, ihre wahren Fähigkeiten nüchtern zu erkennen, Selbstzufriedenheit zu überwinden und sich ständig zu verbessern. Es ist im Wesentlichen eine Lektion in Demut und Lernbereitschaft.
Die Folgen dieser Philosophie sind jedoch nicht ohne Schattenseiten. Sie schafft ein Paradoxon, über das es sich nachzudenken lohnt: Es sind die „bescheidenen“ Zeugnisse mit einer Reihe von 5ern und „sicheren“ 5ern, die für Studierende beim Eintritt in den Arbeitsmarkt oder bei der Suche nach Stipendien für ein Auslandsstudium zur Belastung werden.
In den Augen vieler Arbeitgeber oder internationaler Universitäten – insbesondere europäischer Universitäten, an denen oft ein Mindest-GPA-Schwellenwert gilt – werden diese Ergebnisse leicht als eingeschränkte Fähigkeiten missverstanden, wodurch begabten Studenten leider unbeabsichtigt viele wertvolle Möglichkeiten verwehrt werden.
Der Wendepunkt des Kreditsystems und das Paradox der Instabilität
Der große Wendepunkt kam mit der flächendeckenden Einführung des kreditbasierten Ausbildungssystems und der 4-Punkte-Skala. Unser Abschlussjahrgang 2009 an der Fakultät für Architektur war einer der ersten, der diesen Wandel erlebte. Es ergab sich ein Paradoxon: Während die Schule weiterhin den „erstickenden“ Notenstandard auf einer 10-Punkte-Skala beibehielt, mussten die Schüler für eine 1 (4,0) auf einer 4-Punkte-Skala mindestens 8,5 von 10 Punkten erreichen.
Das Ergebnis war vorhersehbar. Unsere Zeugnisse waren erbärmlich „bescheiden“, wenn man sie in eine Buchstabennote umrechnete. Die besten Studenten blieben bei B (3,0) stehen – was nach den Anforderungen einiger amerikanischer Universitäten gerade so zum Abschluss reicht (Studenten müssen einen Mindest-GPA von 3,0/4,0 erreichen, um ihren Abschluss zu machen).
Wir Insider befanden uns in einer verwirrenden Situation: Wir gaben unser Bestes, aber die Ergebnisse auf dem Zeugnis waren mit denen anderer Schulen nicht vergleichbar. Wir waren sogar beim Studium im Ausland oder bei Bewerbungen bei multinationalen Unternehmen benachteiligt. Auch die Lehrer waren verwirrt – zwischen alten Benotungsgewohnheiten und dem Druck eines neuen Systems.
Die Ära der „Punkteinflation“ und ihre unvorhersehbaren Folgen
Während die Erinnerungen an die „erstickenden“ Noten der vorherigen Generation nicht verblasst sind, offenbart die Realität der heutigen Universitätsausbildung ein Paradoxon.
In den Medien stößt man immer wieder auf erstaunliche Zahlen: Die Quote exzellenter und guter Absolventen an vielen großen Universitäten steigt stetig an, mancherorts wird sogar ein Wert von weit über 80 Prozent bis zum Jahr 2025 verzeichnet.
Eine sorgfältige Analyse der Daten der Absolventenrankings der letzten Jahre zeigt einen bemerkenswerten Trend: einen stetigen, manchmal dramatischen Anstieg des Anteils der Studenten, die mit Auszeichnung abschneiden.
Insbesondere an den zentralen Ausbildungsstätten der Wirtschaft ist die Quote exzellenter und guter Absolventen nicht nur hoch, sondern überwältigend und macht den Großteil der Gesamtzahl der Bachelorabschlüsse aus.
Diese Diskrepanz wirft zwangsläufig Fragen hinsichtlich der Einheitlichkeit der Bewertungsstandards zwischen den Ausbildungsbereichen und, was noch wichtiger ist, hinsichtlich der wahren Bedeutung guter Abschlüsse auf dem heutigen Arbeitsmarkt auf.
Der Grund dafür ist nicht mysteriös. Er liegt im Notensystem. Mit der Regelung, dass ein Schüler nur 8,5 von 10 Punkten erreichen muss, um eine Eins – die beste Note – zu erhalten, wurde ungewollt eine Tendenz zur „Lockerung“ der Notenkriterien gefördert. Infolgedessen sind Kurse mit 50 % oder sogar 70–80 % Einser-Quoten keine Seltenheit mehr.
Die Folgen der „Noteninflation“ beschränken sich nicht nur auf schöne Zeugnisse. Sie zerstört auch die Kernfunktion von Noten: die Differenzierung tatsächlicher Fähigkeiten. Wenn alle gut sind, ist in den Augen der Arbeitgeber niemand wirklich gut.
Sie sind gezwungen, tiefer zu graben und auf komplexe Auswahlinstrumente wie Eignungstests, Verhaltensinterviews oder Assessment-Center zurückzugreifen, um zusätzliche Tests durchzuführen (Assessment-Center ), was zu einem erheblichen Anstieg der Rekrutierungskosten und des Zeitaufwands führt. Der tatsächliche Wert eines Universitätsabschlusses wird daher in Frage gestellt.
„Bell Curve“ – Wunder oder notwendige Bittermedizin?
In diesem Zusammenhang wird die „Glockenkurve“ als mögliche technische Lösung zur Inflationskontrolle erwähnt. Der Kern der Glockenkurve liegt nicht in einer Änderung der Lehr- oder Benotungsmethoden . Wir müssen auch nicht die Benotungs- oder Bewertungsmethoden wie bisher reformieren oder ändern, sondern die Änderung liegt in der endgültigen Umstellung und Benotung.
Anstelle einer festen A-Note, die direkt in A-, B-, C- oder D-Noten umgerechnet wird, werden die Schüler bei dieser Methode anhand der relativen Leistungsverteilung in der Klasse eingestuft. Nur ein bestimmter Prozentsatz (z. B. 10–15 %) erhält die Note A, die Mehrheit die Note B oder C und ein kleiner Teil die Note D.
Diese Methode, die an vielen internationalen Universitäten wie Stanford, Harvard oder direkt am RMIT Vietnam angewendet wird, trägt dazu bei, dass die Noten die Position eines Studenten in der Gruppe relativ genau widerspiegeln und so die Situation kontrolliert wird, dass „nur Einsen“ kommen oder die ganze Klasse nur Fünfen hat, oder „rettende“ Fünfen ... gerade genug, um das Fach zu bestehen.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Differenzierung wird wiederhergestellt, der Wert der Qualifikationen wird gesteigert und den Arbeitgebern wird ein zuverlässigerer Maßstab an die Hand gegeben.
Allerdings ist die Lage nicht immer rosig. Die Glockenkurve hat auch unbestreitbare Nachteile. Sie kann zu unnötigem und manchmal unfairem Wettbewerb führen.
In einer Klasse voller hervorragender Schüler (z. B. einer Klasse für Hochbegabte oder einer Klasse für besonders begabte Schüler) kann ein wirklich begabter Schüler trotz guter Testergebnisse nur dann eine 2 oder 3 erhalten, wenn er nicht zu den Klassenbesten gehört oder wenn viele andere Schüler bessere Ergebnisse erzielen. Diese Methode hat außerdem den Nachteil, dass sie es guten Schülern in einem Umfeld voller guter Schüler oder bei zu geringer Schülerzahl „schwer machen“ kann.
Was ist also die Lösung?
Die Glockenkurve ist kein Allheilmittel, und ihre starre Anwendung ersetzt lediglich ein Problem durch ein anderes. Die Lösung könnte in einer ausgewogeneren und flexibleren Bewertungsphilosophie liegen.
Erstens muss die Anwendung flexibel sein. Die Notenverteilung in der Glockenkurve sollte für alle Fächer und Kurse keine starre Zahl sein (z. B. können bei einer Prüfung nur 10 % der Schüler eine 1 und 30 % eine 2 bekommen), sondern sollte je nach den Besonderheiten der einzelnen Fächer (Ingenieurwesen, Kunst, Wirtschaft usw.), der Klassengröße und sogar der Qualität der Leistungen angepasst und ausgeglichen werden.
Zweitens , und das ist vielleicht noch wichtiger, müssen wir unsere Denkweise über den Zweck von Noten ändern. Noten sollten nicht das Endziel sein, sondern nur ein Feedback für den Lernprozess. Der Kernwert einer Universitätsausbildung liegt in dem Wissen, den Fähigkeiten und dem Denken, das die Studierenden erwerben, und nicht in einer schönen Zahl auf einem Diplom.
Letztendlich ist die Entwicklung einer Bewertungsmethode, die individuelle Leistungen angemessen würdigt und gleichzeitig Objektivität, Transparenz und Klassifizierung gewährleistet, der Schlüssel zur Steigerung des tatsächlichen Werts vietnamesischer Universitätsabschlüsse in der neuen Ära. Dieser Weg erfordert die Zusammenarbeit nicht nur der Bildungsverwaltung, sondern auch der Dozenten, Studierenden und der Wirtschaft.
Quelle: https://tuoitre.vn/chuyen-diem-so-o-dai-hoc-viet-nam-tu-thoi-ky-kho-tho-den-cau-chuyen-lam-phat-diem-20251010231207251.htm


![[Foto] Bereit für die Herbstmesse 2025](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/14/1760456672454_ndo_br_chi-9796-jpg.webp)



















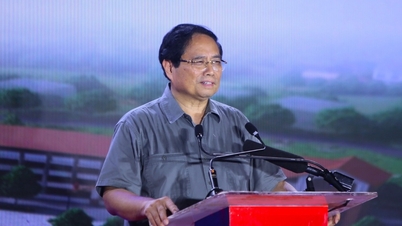























































































Kommentar (0)