Das Projekt soll 50.000 Schulen, 30 Millionen Schüler und eine Million Lehrer erreichen. Um in den nächsten fünf Jahren 200.000 Lehrer für den Englischunterricht auszubilden, wird der Bildungssektor jedoch mit zahlreichen Schwierigkeiten konfrontiert sein.
Der Reporter von Tien Phong interviewte Herrn Le Hoang Phong, den akademischen Direktor der YOUREORG Education & Training Consulting Organization und Chevening Scholar. Er äußerte die Meinung, dass viele Menschen die Vorstellung des Projekts „Englisch bis 2045 zur zweiten Schulsprache machen“ durch das Bildungsministerium als Meilenstein betrachteten. Wir müssen einen Weg finden, daraus eine Bildungsrevolution zu machen oder es nur zu einem unerfüllten Versprechen zu machen.

„Wie viel „Kapazität“ hat unser Lehrerausbildungssystem?“
PV: Werden wir Ihrer Meinung nach bis 2030 in der Lage sein, etwa 12.000 zusätzliche Englischlehrer für Vorschulen und fast 10.000 Grundschullehrer einzustellen und gleichzeitig mindestens 200.000 Lehrer auszubilden, die in der Lage sind, auf Englisch zu unterrichten?
Als das Bildungsministerium das Projekt „Englisch bis 2045 zur zweiten Schulsprache machen“ vorstellte, galt es vielen als Meilenstein. Nicht nur, weil Englisch die „Sprache der Integration“ ist, sondern auch, weil es eng mit dem Streben nach nationaler Aufwertung verbunden ist. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft immer eine Lücke. Und diese Lücke wird entscheiden: Handelt es sich um eine Bildungsrevolution oder nur um ein unerfülltes Versprechen?
Lehrerpersonal: Ambitionen und Grenzen. Das Projekt zielt darauf ab, bis 2030 mehr als 22.000 neue Englischlehrer für Vorschulen und Grundschulen einzustellen und 200.000 bestehende Lehrer so auszubilden, dass sie in der Lage sind, auf Englisch zu unterrichten.
Das ist fast doppelt so viel wie die Zahl der Vollzeit-Englischlehrer. Auf dem Papier entspricht dieses Ziel den globalen Trends. Die UNESCO schätzt, dass weltweit 44 Millionen neue Lehrer benötigt werden, um das Ziel einer allgemeinen Schulbildung bis 2030 zu erreichen.
Die Kernfrage lautet jedoch: Wie viel „Kapazität“ hat unser Lehrerausbildungssystem? Wie viele Studierende sind bereit, den Lehrerberuf zu ergreifen, und wie viele sind bereit, in schwierigen Bereichen zu bleiben? Eine Umfrage in Ho-Chi-Minh-Stadt, wo die Bedingungen am günstigsten sind, zeigt, dass nur 28 % der Lehrer das Niveau B2 oder höher erreicht haben, während die Mindestanforderung B2 für die Grundschule und C1 für die weiterführende Schule ist. Das Problem ist also nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität.
PV: Was war Ihrer Meinung nach die größte Schwierigkeit, auf die wir bei der Umsetzung des Projekts gestoßen sind, Sir?
Ich denke, der größte Engpass sind die Menschen, die Motivation und der Konsens. Bei jeder Reform ist der Lehrplan nur ein Rahmen; diejenigen, die diesen Rahmen in die Tat umsetzen, sind die Lehrkräfte. Dieses Projekt erfordert von den Lehrkräften nicht nur gute Englischkenntnisse, sondern auch die CLIL-Methode, sowohl in der Vermittlung von Fachwissen als auch in der Entwicklung von Fremdsprachen. Dies ist eine komplexe Kompetenz, die sich nicht in ein paar kurze Kurse „packen“ lässt.
Gleichzeitig stellen Motivation und Behandlung ein großes Hindernis dar. Niedriges Gehalt und hoher Druck – von Lehrern kann man nicht erwarten, dass sie sich mit ganzem Herzen innovativ engagieren, wenn sie keine angemessene Belohnung erhalten. Ohne einen Mechanismus aus Zulagen, Aufstiegsmöglichkeiten und sozialer Anerkennung ist es schwierig, berufliches Durchhaltevermögen zu mobilisieren. Wir können von einem Team, dessen Politik es immer noch mit Personalmangel zu kämpfen hat, keine Spitzenleistungen verlangen.
Darüber hinaus gibt es berechtigte Bedenken in der Gesellschaft. Manche Eltern befürchten, dass eine zu frühe Einführung der englischen Sprache die vietnamesische Sprache verdunkelt und die kulturelle Grundlage schwächt. Jim Cummins‘ Theorie hat bewiesen, dass eine Fremdsprache nur dann Wurzeln schlagen kann, wenn die Muttersprache solide ist. Wird dieser Kompromiss eingegangen, besteht die Gefahr, dass eine Generation beide Sprachen „unausgereift“ beherrscht.
Die größte Herausforderung besteht also nicht in der Anzahl der Lehrbücher oder des zweisprachigen Unterrichts, sondern darin, die Lehrer kompetent, motiviert und zuversichtlich genug zu machen, dass die Gesellschaft auf ihrer Seite steht.
PV: Sollten wir Ihrer Meinung nach regionale Faktoren berücksichtigen, um die Durchführbarkeit des Projekts zu erhöhen?
Regional: Gerechtigkeit ist entscheidend. Betrachtet man nur Hanoi oder Ho-Chi-Minh-Stadt, scheint das Projekt machbar. Doch außerhalb der Großstädte bietet sich ein völlig anderes Bild.
Derzeit studieren landesweit nur 112.500 Schüler englischsprachige Fächer, dazu kommen 77.300 zweisprachige Schüler in 40 Provinzen und Städten. Das bedeutet, dass mehr als 20 Provinzen über kein EMI-Modell verfügen.
In vielen Bergprovinzen sprechen die Schüler noch nicht fließend Vietnamesisch, und nun wird Englisch zu einer „doppelten Belastung“.
Ein Vertreter des Bildungsministeriums von Tuyen Quang sagte offen: Dies sei eine „sehr schwere“ Aufgabe. Wenn gemeinsame Fortschritte erzielt würden, würden benachteiligte Gebiete bald abgehängt. Die Antwort sei ein geschichteter Fahrplan. Städtische Gebiete könnten den Anfang machen und mit gutem Beispiel vorangehen; benachteiligte Gebiete benötigen mehr Zeit und Ressourcen, wobei die Stärkung des Vietnamesischen vor der Stärkung des Englischen Vorrang haben sollte.
Noch wichtiger ist, dass die Finanzierung und Anreize gezielt in die ärmsten Gebiete gelenkt werden. Sonst wird „Englisch als Zweitsprache“ zu einem städtischen Privileg und nicht zu einem gleichberechtigten Zugangsrecht für alle Kinder.
Die Botschaft muss klar sein: Englisch ist eine Ergänzung, kein Ersatz für Vietnamesisch.
PV: Welche Grundlagen müssen Ihrer Meinung nach geschaffen werden, damit das Projekt Wirklichkeit wird?
Um dieses Ziel zu verwirklichen und Englisch tatsächlich zur Zweitsprache im Bildungssystem Vietnams zu machen, braucht Vietnam drei Grundpfeiler. Jeder dieser Pfeiler steht nicht für sich allein, sondern ist in ein politisches Ökosystem eingebunden, in dem Ressourcen, Motivation und soziales Vertrauen zusammenwirken.
Im Mittelpunkt der Reform stehen die Menschen, das Lehrpersonal. Ohne qualifizierte Lehrkräfte kann keine Sprachreform erfolgreich sein. Erfahrungen aus Singapur oder Finnland zeigen, dass Lehrkräfte als „intellektuelle Berufe“ gelten, streng ausgewählt, gut ausgebildet und hoch entlohnt werden.
Für Vietnam ist es notwendig, ein Kernteam von Lehrern zu bilden, von denen etwa 10–15 % eine umfassende Ausbildung in CLIL/EMI haben und als Kern für den Wissensaustausch fungieren.
Gleichzeitig muss es eine Politik der Mitarbeiterbindung geben: Fremdsprachenzuschüsse, Aufstiegsmöglichkeiten und gesellschaftliche Anerkennung. Andernfalls droht uns ein „Brain Drain“, bei dem gute Lehrkräfte die öffentlichen Schulen verlassen oder den Beruf aufgeben. Investitionen in Menschen sind die Investitionen mit dem größten „Streuungskoeffizienten“, denn jeder gute Lehrer kann im Laufe seiner Karriere Hunderte von Schülern beeinflussen.
Dieses Projekt ist eine historische Chance, aber auch eine harte Prüfung für die politische Gestaltungsfähigkeit. Die Frage lautet nicht mehr: „Wollen wir es?“, sondern: „Haben wir den Mut, in Lehrkräfte zu investieren, geduldig einen langfristigen Fahrplan zu verfolgen und entschlossen zu sein, Gleichberechtigung in den Mittelpunkt zu stellen?“ Wenn die Antwort „Ja“ lautet, wird Vietnam bis 2045 eine Generation haben, die es versteht, sich zu integrieren, ohne sich selbst zu verlieren. Andernfalls wird diese Vision für immer auf dem Papier bleiben.
Darüber hinaus braucht es einen flexiblen Fahrplan, der sich an Zwischenzielen und nicht an Vertrauen orientiert. Ein 20-Jahres-Plan ist nur dann sinnvoll, wenn er klare Kontrollpunkte enthält. Vietnam muss für 2026, 2028 und 2030 Meilensteine mit quantitativen Indikatoren festlegen: – 2026: Mindestens 60.000 Lehrkräfte erfüllen die B2-Standards, 10 Provinzen führen EMI-Pilotprojekte durch. – 2028: 140.000 Lehrkräfte erfüllen die Standards, 25 Provinzen wenden EMI an. 2030: 200.000 Lehrkräfte erfüllen die Standards, EMI wird auf mindestens 40 Provinzen ausgeweitet.
Warum der Meilenstein 2026–2028–2030? Dies ist die Zuteilungsmethode nach dem 30%-70%-100%-Prinzip: 2026 beweist die Machbarkeit (30% des Ziels), 2028 baut sie soziales Vertrauen aus und schafft es (70%), 2030 wird das Ziel erreicht (100%). Die derzeitige Ausbildungskapazität ermöglicht die Ausbildung von etwa 30.000 bis 40.000 Lehrern pro Jahr. In fünf Jahren kann das System bei hohen Investitionen etwa 200.000 Lehrer ausbilden.
Beim EMI werden zehn Pionierprovinzen als „Leuchtturm“ fungieren, 25 Provinzen werden 2028 einen Spillover-Effekt erzeugen und 40 Provinzen werden 2030 eine Masseneinführung sicherstellen, haben aber bis 2045 noch Raum für eine Ausweitung. Auf diese Weise lässt sich ein „Sprint“ im letzten Jahr vermeiden, wie ihn das Fremdsprachenprojekt 2020 aufgrund fehlender Zwischenkontrollen scheiterte. Die Erfahrungen mit dem Fremdsprachenprojekt 2020 zeigen, dass Reformen ohne unabhängige Aufsicht leicht zu einem Streben nach Quantität und Vernachlässigung der Qualität werden können.
Der Fahrplan muss außerdem nach Regionen geschichtet werden: Städtische Gebiete sind zuerst dran, schwierige Regionen kommen langsamer voran, erhalten aber besondere Unterstützung.
Sozialer Konsens und die sanfte Kraft der Sprachreform sind nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch eine kulturelle Identität. Daher ist der soziale Konsens die entscheidende Säule. Die Botschaft muss klar sein: Englisch ist eine Ergänzung, kein Ersatz für Vietnamesisch. Dies ist das Modell der „additiven Zweisprachigkeit“, bei dem die Muttersprache gestärkt und nicht verdrängt wird. Für Kinder ethnischer Minderheiten ist ein Fahrplan Muttersprache → Vietnamesisch → Englisch erforderlich, um eine Überlastung zu vermeiden.
Konsens entsteht erst, wenn Eltern sehen, dass ihre Kinder Fortschritte in Englisch machen, Vietnamesisch beherrschen und ihre kulturellen Wurzeln bewahren. Englisch ist der Schlüssel zur Welt. Doch dieser Schlüssel ist nur dann wertvoll, wenn die vietnamesischen Schüler gut Englisch sprechen, Vietnamesisch beherrschen und sich ihrer Identität sicher sind.

Werden Fremdsprachenlehrer „arbeitslos“, wenn Englisch zur Zweitsprache wird?

IELTS-Zertifikat wird zum „Lebensretter“

Schöne englische Partitur: Warum ist sie so instabil und beunruhigend?
Quelle: https://tienphong.vn/tieng-anh-la-ngon-ngu-thu-mot-phep-thu-khac-nghiet-ve-nang-luc-quan-tri-chinh-sach-post1783098.tpo



![[Foto] Die Binh-Trieu-1-Brücke wurde fertiggestellt, um 1,1 m erhöht und wird Ende November für den Verkehr freigegeben.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/2/a6549e2a3b5848a1ba76a1ded6141fae)



















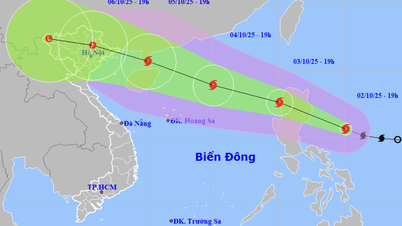













































































Kommentar (0)